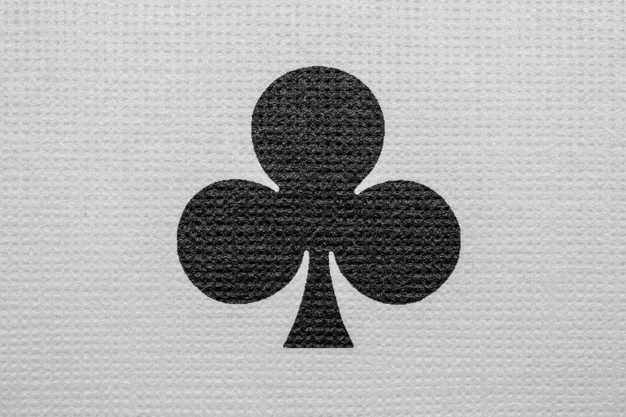Schlagwort: Gesellschaftszweck
Dieser Artikel erläutert den Estrich als FuÃÂbodenaufbau; in der Schweiz bezeichnet Estrich den Dachboden.
Als Estrich (althochdeutsch esterih; über lateinisch astracus, astricus âÂÂPflaster (aus Tonziegeln)â von altgriechisch á½ÂÃÂÃÂÃÂñúÿý .mw-parser-output .Latn{font-family:“Akzidenz Grotesk“,“Arial“,“Avant Garde Gothic“,“Calibri“,“Futura“,“Geneva“,“Gill Sans“,“Helvetica“,“Lucida Grande“,“Lucida Sans Unicode“,“Lucida Grande“,“Stone Sans“,“Tahoma“,“Trebuchet“,“Univers“,“Verdana“}óstrakon âÂÂScherbe, irdenes TäfelchenâÂÂ) bezeichnet man in Deutschland den Aufbau des FuÃÂbodens als ebenen Untergrund für FuÃÂbodenbeläge. Estriche werden je nach entsprechender Art und Ausführung auch fertig nutzbarer Boden genannt.
Das schweizerische Wort für Estrich ist Unterlagsboden, das Wort âÂÂEstrichâ bezeichnet dort den Dachboden.
Grafische Darstellung eines FuÃÂbodens
Neben seiner Aufgabe als âÂÂFüll- und Ausgleichsstoffâ ist ein Estrich vor allem als Lastverteilungsschicht anzusehen, unter der sich Heizungen, Wärme- und Schalldämmungen befinden können. Er kann ebenso die direkte Nutzschicht sein.
Eine Sonderform ist der sogenannte âÂÂNutzestrichâ oder âÂÂSichtestrichâÂÂ. Dabei ist der Estrich gleichzeitig die âÂÂNutzschichtâ ohne Oberbodenbelag. Estrich wird aus Estrichmörtel hergestellt, dieser besteht aus einer Gesteinskörnung (meist Sand) und einem Bindemittel (z. B. Zement, Calciumsulfat, Magnesiumoxid, Bitumen). Alternativ dazu gibt es auch Trockenestrich aus Fertigteilplatten.
Frisch verlegter EstrichfuÃÂboden
Inhaltsverzeichnis
1 Definition
2 Estriche nach Bindemittel und Zuschlag
2.1 Zementestrich (CT)
2.2 Gussasphaltestrich (AS)
2.3 Kunstharzestrich (SR)
2.4 Calciumsulfatestrich (CA)
2.5 Magnesiaestrich (MA)
2.6 Lehmestrich
2.7 Faserbewehrte Estriche
3 Konstruktionsarten
3.1 Verbundestrich
3.2 Estrich auf Trennlage
3.3 Schwimmender Estrich und Heizestrich auf Dämmschicht
3.4 Trockenestrich
4 Flüssig eingebrachte Estriche
4.1 Abbindeverhalten
4.2 Belegereife
5 Normen
6 Konformitätskontrolle
7 Weblinks
8 Einzelnachweise
Definition
Die DIN EN 13318 definiert den Begriff Estrich wie folgt: Schicht oder Schichten aus Estrichmörtel, die auf der Baustelle direkt auf dem Untergrund, mit oder ohne Verbund, oder auf einer zwischenliegenden Trenn- oder Dämmschicht verlegt werden, um eine oder mehrere der nachstehenden Funktionen zu erfüllen:
den Druck gleichmäÃÂig auf die darunterliegende Dämmung verteilen
gleichmäÃÂiger Untergrund für einen Bodenbelag
unmittelbare Nutzbarkeit
eine vorgegebene Höhenlage zu erreichen[1]
Estriche nach Bindemittel und Zuschlag
Estriche können nach ihren Bindemitteln unterschieden werden.
Zementestrich (CT)
Der bekannteste Estrich ist der nach DIN EN 13 813 als CT (von Cementitious screed) bezeichnete Zementestrich. Es handelt sich dabei um einen Mörtel, dessen KorngröÃÂe und Mischung auf seine spezielle Verwendung optimiert wurden. ÃÂblicherweise werden KorngröÃÂen bis zu 8 mm verwendet. Bei Estrichdicken über 40 mm darf das GröÃÂtkörn maximal 16 mm groàsein. Das Mischverhältnis von Zement zu Sand liegt etwa bei 1:5 bis 1:3.
Der Zementestrich (CT) hat den Vorteil der Beständigkeit gegenüber Wasser nach der Aushärtung. Und auch Kälte und Hitze sind keine Probleme. AuÃÂerdem können mit Zement als Bindemittel hohe Festigkeiten erreicht werden. Nachteilig ist die Anfälligkeit des Zements für chemische Angriffe (z. B. durch Säuren) und das Verhalten auf Dämmungen oder Trennlagen. Durch âÂÂSchrumpfungsvorgängeâÂÂ, die sich beim Erhärtungsvorgang des Estrichs in Kriechen und Schwinden infolge der ungleichmäÃÂigen Hydratation ausdrücken, ist die FeldgröÃÂe in der Regel auf 36 mò zu begrenzen, da sich in der Konstruktion sonst unkontrolliert Risse bilden. Des Weiteren benötigt der Zementestrich relativ lange bis er belegereif ist.
Zementestrich erfordert nach dem Mischvorgang eine unverzügliche Verarbeitung. Und beim Einbringen und während der ersten drei Tage der Erstarrung eine Mindesttemperatur von 5 ðC (auch nachts). Während der Erstarrungsphase darf diese Temperatur nicht unterschritten werden, da sonst mit starken Festigkeitsverlusten zu rechnen ist. Der Estrich ist auÃÂerdem vor Zugluft und Wassereintrag (undichtes Dach, Auskippen von Wasser usw.) zu schützen. Die Zugluft führt durch den Kapillarzug zu einer erhöhten Hydratation im Oberflächenbereich. Das bedeutet, dass âÂÂobenâ ein kleineres Volumen ist als âÂÂuntenâ und der Estrich stark schüsselt. Zu viel Wärme zum Beispiel durch Zwangstrocknungen mit Heizungen führen zum Abbruch der Hydratation bzw. des Kristallwachstums. Daraus resultiert ein Schaden, wenn der Estrich Feuchte bekommt, z. B. durch Wasser aus einem Verlegemörtel. Die Begehbarkeit richtet sich nach der Art des Zements (CEM I, CEM II), der Dicke und den Umgebungsbedingungen. Ein schwimmend verlegter Zementestrich sollte frühestens nach 3 Tagen begangen werden. Nach 28 Tagen kann die erste Feuchtemessung durchgeführt werden.
Soll der Zementestrich mit einem Bodenbelag versehen werden, so muss der Estrich âÂÂgenügend trockenâ (3.1.1 der DIN 18365 â Bodenbelagsarbeiten) sein. Nach einer Empfehlung zweier Verbände aus dem Jahr 2007 soll die Feuchtigkeitsmessung mit der Calciumcarbid-Methode (CM) nach DIN 18560 durchgeführt werden. Die so genannte Belegreife soll erreicht sein, wenn der Estrich eine Restfeuchte von maximal 2,0 CM % (unbeheizt) bzw. 1,8 CM % (beheizt) aufweist. Sowohl die Messmethode als auch die empfohlenen Grenzwerte werden kritisiert; nach einer im März 2012 veröffentlichten Studie der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) und der Universität Siegen trennt der CM-Grenzwert von 2 % belegreife Estriche nicht sicher von nicht belegreifen Estrichen. Bei diesem Grenzwert werden auch nasse Estriche als trocken bewertet.[2] Die DIN 18560 sagt auÃÂerdem, dass die Beurteilung der Belegreife zur Prüfpflicht des Oberbodenlegers direkt vor der Verlegung gehört
Bisher wird die Feuchtemessung bei Estrichen jedoch weiterhin nach der CM-Methode nach DIN 18560-1 durchgeführt. Die aktuellste Version der Norm DIN EN 18560 ist aus dem Jahre 2015. Diese Prüfmethode gilt auch für Calciumsulfat- und Magnesiaestriche, nicht aber für Kunstharz- und nicht für Gussasphaltestriche.
Schnellestriche auf Zementbasis bestehen aus Zement mit Zusätzen. Hier gelten andere Bedingungen für die Erhärtung und die Belegreife, die von Art und Wirkung des Zusatzes abhängt. Diese Estriche unterliegen nicht der DIN 13813 und gelten als Sonderkonstruktion. In dem Merkblatt 14 der Technischen Kommission Bauklebstoffe (TKB) wird festgestellt, dass sich bei Schnellestrichen grundsätzlich keine verlässlichen Aussagen zur Belegreife machen lassen. Die Ausnahme bilden Estriche mit ternären Bindemitteln. Dabei handelt es sich um Drei-Stoffgemische bestehend aus Portland-/Normalzement, Aluminatzement (Tonerdeschmelzzement), Calciumsulfat und weiteren Additiven. Dabei sind die Angaben vom Hersteller maÃÂgeblich.
Ausgestemmter Zementestrich gilt als normaler Bauschutt, sofern keine organischen Bestandteile >5 % enthalten sind. Grundlage dafür ist die Verordnung über das Europäische Abfallverzeichnis (AVV).
Gussasphaltestrich (AS)
Der wasserfreie Gussasphaltestrich (AS) (von Mastic Asphalt screed) nach DIN EN 12591 besteht aus einem Gemisch aus Bitumen und Gesteinskörnungen (einschlieÃÂlich Füller). Je nach Belastungsanforderungen werden normalerweise maximale KorngröÃÂe zwischen fünf und elf Millimeter verwendet.
Da dieses Gemisch auf eine Temperatur zwischen 220 ðC und 250 ðC erhitzt werden muss, ist der Gussasphaltestrich beim Einbau gieÃÂ- und streichbar und braucht nicht verdichtet zu werden. Er kann schwellen- und fugenlos eingebracht werden. Seine geringe Wärmeleitfähigkeit und seine trittschallmindernde Eigenschaft können dazu führen, dass abhängig von den bauphysikalischen Anforderungen an die Deckenkonstruktion keine Dämmungen eingebaut werden müssen. Er ist wasser- und wasserdampfdicht und stellt in Verbindung mit geeigneten Bitumen-SchweiÃÂbahnen oder einer Asphaltmastix eine Abdichtung im Sinne der DIN 18195 dar.
Die Einbaudicke von Gussasphaltestrich beträgt mindestens 20 mm. Liegt die Einbaudicke bei über 40 mm so muss der Estrich in zwei Lagen eingebracht werden. Vor dem Erkalten wird die Oberfläche mit feinem Sand abgerieben.
Der Gussasphaltestrich kann entweder als Verbundestrich mit einer Bitumen-SchweiÃÂbahn als Haftbrücke oder als Schwimmender Estrich auf einer Trennlage mit Dämmschicht eingebaut werden. Auch als Heizestrich ist Gussasphalt einsetzbar, wobei hier nur die Härteklasse ICH 10 zulässig ist. Gussasphaltestrich wird, im Gegensatz zu Estrichen mit anderen Bindemitteln, aufgrund seiner Stempeleindringtiefe (nach DIN EN 12697-20) klassifiziert. Es gibt die Härteklassen IC 10, IC 15, IC 40, IC 100. Je höher die Zahl, desto weicher der Estrich.
Vor einer Belegung mit mineralischen Werkstoffen (Naturstein, Keramik, Betonwerkstein) ist i. d. R. eine Entkopplung oder eine Sperrschicht zu erstellen. Mörtelwasser ist hochalkalisch und kann die Oberfläche des AS kalt verseifen und eine Anhaftung erschweren. Hinzu kommt eine Verfärbungsgefahr durch wandernde bituminöse Stoffe. Ein weiterer Nachteil ist die langsame Bewegung bei Wärme und statischen und dynamischen Lasten.
Der gröÃÂte Vorteil des Gussasphaltestrichs ist die kurze Belegreife, so lässt sich ein Gussasphaltestrich meist schon nach einer kurzen Abkühlzeit von 2âÂÂ3 Stunden begehen und im besten Fall nach etwa 4 Stunden belegen. Und die Verlegung ist unabhängig von der AuÃÂentemperatur oder Witterung. Zusätzlich ist Gussasphaltestrich resistent gegen die meisten Laugen und Säuren und somit auch für IndustriefuÃÂböden interessant.
Der gröÃÂte Nachteil sind die hohen Kosten. AuÃÂerdem ist der Einbau in oberen Stockwerken oft problematisch, da der Estrich kaum pumpfähig ist.
Kunstharzestrich (SR)
Mit der internationalen Bezeichnung SR (von synthetic resin screed) werden Kunstharzestriche, in der Regel Epoxydharzestriche, bezeichnet. Aber auch Polyurethan, Polymethylmethacrylat und andere Kunststoffe sind möglich. AuÃÂerdem werden oft Farbpigmente zugegeben. Kunstharzestriche werden auf trockenen Untergrund meist in einer einzigen dünnen Schicht von ca. 8âÂÂ15 mm eingebaut. Er ist unmittelbar nach dem Mischvorgang zu verarbeiten und eine Verdichtung ist in der Regel auch notwendig.
Diese sehr teuren Untergründe werden nur in Sonderfällen eingebaut, zum Beispiel wenn man kurze Trocknungszeiten oder hohe dynamische Belastbarkeit benötigt. Die Schrumpfung bei der Polyaddition liegt je nach Produkt bei 1 bis 5 Prozent. Dies ist bei der Auswahl des Verlegematerials zu berücksichtigen.
Kunstharzestrich ist wasserbeständig, er bildet eine nicht staubende flüssigkeitsdichte Schicht die für schwere mechanische Beanspruchung genutzt werden kann. Gegen die meisten Chemikalien ist der Estrich unempfindlich. Neben dem hohen Preis ist gibt es noch den Nachteil, einer möglichen Gefahr durch die Härter, wie z. B. Bisphenol A. Diese stehen in dem Verdacht, Unfruchtbarkeit zu verursachen. Auch ist ggf. eine ÃÂnderung der Brandklasse der Gesamtkonstruktion möglich. Der Estrich verliert bei höheren Temperaturen seine Beständigkeit und kann in der Regel Temperaturen über 100 ðC nicht widerstehen. Polykondensate, wie Polyester, sind durch die hohe Schrumpfungsrate nicht geeignet.
Die Aushärtungszeiten sind von dem gewählten Kunstharzbindemittel, sowie den Temperaturen bei Einbau und Aushärtung abhängig. Nach 3 bis 7 Tagen ist der Estrich üblicherweise belastbar.
Kunstharzestrich gilt als Sondermüll und muss beim Entsorger entsprechend deklariert werden.
Calciumsulfatestrich (CA)
â Hauptartikel: Anhydritestrich
Unter Calciumsulfatestriche (CA) werden Estriche zusammengefasst, deren Bindemittel auf Calciumsulfathalbhydrat oder auf wasserfreiem natürlichem oder synthetischem Calciumsulfat (sogenannter Anhydrit) besteht. Mit Wasser reagierend entsteht Calciumsulfatdihydrat (Gips). Calciumsulfatestriche werden nach DIN EN 13813 mit CA (vom englischen âÂÂcalcium sulfat screedâÂÂ) gekennzeichnet und umgangssprachlich häufig als Anhydritestrich bezeichnet.
Aufgrund des geringen Schwindverhaltens weisen CA nicht das für Zementestrich übliche Schüsseln bzw. spätere Randabsenkungen auf und können groÃÂflächig (bis zu 1000 mò) ohne Dehnfugen verlegt werden. Bewegungsfugen der Unterkonstruktion sind jedoch trotzdem zu übernehmen und bei Kombination mit einer FuÃÂbodenheizung sind auch Dehnungsfugen vorzusehen. Sie werden als konventionell zu verarbeitender Estrich oder als FlieÃÂestrich eingebaut und sind mit 2âÂÂ3 Tagen früh begehbar. Calciumsulfatestriche sollten frühestens nach 5 Tagen höher belastet werden.
Als FlieÃÂestriche können CA nach DIN 18560-2 auch mit CAF gekennzeichnet werden. CAF haben die weiteren Vorteile der schnellen, verarbeitungsfreundlichen Verlegung, der geringeren Estrichdicke und der guten Wärmeleitfähigkeit bei Heizestrichen.
Calciumsulfatestriche sind ökologisch und biologisch unbedenklich und benötigen auÃÂerdem keine Nachbehandlung. Allerdings muss der Estrich nach dem Einbringen mindestens zwei Tage auf mindestens 5 ðC warm gehalten werden und vor schädlichen Einwirkungen wie zum Beispiel Schlagregen, zu starker Erwärmung oder Zugluft geschützt werden
CA sind nicht wasserbeständig und dürfen keiner andauernden Durchfeuchtung ausgesetzt werden. Sie sind deshalb nicht für den Einsatz in gewerblichen Nassräumen oder für AuÃÂenanwendung geeignet. In häuslichen Feuchträumen (z. B. Bad) werden sie durch eine Verbundabdichtung geschützt.
Bei späterer Durchfeuchtung ist ein höheres Schimmelrisiko als bei Zement- oder Gussasphaltestrich zu erwarten.
Vor Belagsverlegung bzw. Voranstrich muss der CA auf eine Restfeuchte von 0,5 %, als Heizestrich auf 0,3 % heruntertrocknen. Die Restfeuchte wird mit einem CM-Messgerät ermittelt.
Calciumsulfatestrich gilt als normaler Bauschutt, wenn organische Bestandteile einen Anteil von 5 % nicht überschreiten.
Magnesiaestrich (MA)
â Hauptartikel: Steinholz (Belag)
Magnesiaestrich MA (von Magnesite screed) ist auch unter der früheren Bezeichnung als Steinholz bekannt. Nach 1945 war Zement rationiert, Magnesit nicht. Deshalb ist er in vielen Altbauten zu finden. Magnesia ist vielen von Turnwettbewerben als âÂÂTrockenmittelâ für die Hände bekannt. 1867 entdeckte Stanislas Sorel, dass Magnesia mit Magnesiumchlorid zu einer zementartigen Masse erstarrt. MA ist leicht einfärbbar und wurde oft mit Holzmehl oder Holzstückchen vermischt.
Magnesiaestrich wird heute nach DIN 14016 aus kaustischer Magnesia (MgO) und einer wässrigen Magnesiumsalzlösung (MgCl2, MgSO4) hergestellt. Als Zuschlag werden anorganische oder organische Füllstoffe verwendet. AuÃÂerdem wird teilweise Farbpigmente hinzugegeben
Sein besonderer Vorteil ist das geringe Gewicht und, aufgrund seiner Leitfähigkeit die Einsatzmöglichkeit als antistatischer Fertigboden. AuÃÂerdem weist er gute Wärme- sowie Schalldämmungswerte auf. Sein groÃÂer Nachteil ist die Feuchteempfindlichkeit und Korrosivität gegenüber Metallen, da bei Wasserzugabe das enthaltene Chlorid und Magnesiumhydroxid âÂÂausgewaschenâ werden und der MA aufquillt. Er darf nie direkt mit wässrigem Mörtel in Kontakt kommen. Eine typische Verwendung heute ist die Verwendung als Nutzestrich für groÃÂe trockene Flächen.
Wie die meisten anderen Estrichmörtel auch, muss Magnesiaestrich unverzüglich nach dem Mischvorgang eingebaut werden. Während des Einbaus und die folgenden zwei Tage muss die Temperatur über 5 ðC gehalten werden. AuÃÂerdem ist der frische Mörtel für mindestens zwei Tage vor Wärme, Schlagregen und Zugluft zu schützen. Der Estrich ist frühstens nach zwei Tagen begehbar und sollte mindestens fünf Tage nicht höher belastet werden. Weiterhin ist Magnesiaestrich über Spannbetondecken wegen der hohen Korrosionsgefahr unzulässig.
Lehmestrich
â Hauptartikel: Lehmestrich
Lehmestrich wurde traditionell als Stampflehmboden eingesetzt. Er findet heute im biologischen bzw. alternativen Bauen Verwendung und spielt im kommerziellen Baubetrieb keine Rolle. Aufgrund der geringeren Zugfestigkeit wird feucht eingebrachter Lehmestrich in der Regel im Verbund (oder auf Trennlage) eingebracht. Erhältlich sind aber faserhaltige Lehmbauplatten, die als Trockenestrich schwimmend verlegt werden können.
Faserbewehrte Estriche
Eine Bewehrung für Estriche ist nach DIN 18560 grundsätzlich nicht erforderlich. Sinnvoll ist sie hauptsächlich bei Zementestrichen auf Dämmschichten zur Aufnahme von Stein- oder Keramikbelägen. Neben der Möglichkeit einer Bewehrung mit Estrichgittern gibt es die Faserbewehrung. Die Estrichgitter sind auf weichen Dämmschichten schwer lagegenau einzubauen und erschweren darüber hinaus den sauberen Einbau einer Estrichschicht, besonders auf Dämmschichten oder bei Heizelementen. Eine Faserbewehrung ist hingegen einfach einzubauen, die Fasern (Stahlfasern, alkalibeständige Glasfasern, Kunststofffasern) werden dem Estrichmörtel zugemischt. Eine Faserbewehrung wird hauptsächlich zur Verminderung von Rissen eingesetzt. Eine vollständige Vermeidung von Rissen kann auch mit einer Faserbewehrung nicht erreicht werden. Die Funktion einer konstruktiven Bewehrung können Fasern erst bei höherer Menge, welche bei Estrichen unüblich sind, übernehmen. Die Zugabe von Fasern kann die Bildung von Schrumpf- und Frühschwindrissen im Estrich verringern. Anzumerken ist jedoch, dass eine Faserzugabe die Konsistenz des Estrichmörtel herabsetzt und so die Verarbeitung erschwert. Gegenüber früher üblichen Stalhbewehrungsmatten ist eine Faserbewehrung deutlich preisgünstiger.
Für alle zementgebundenen Estriche empfehlen sich alkaliresistente (AR) Glasfasern. Diese sind auch bei der alkalischen Umgebung im Zement beständig. Besonders sinnvoll ist die Verwendung bei Heizestrichen oder Untergründen für keramische oder Natursteinbeläge.
Konstruktionsarten
Bei den Konstruktionsarten des Estrichs wird nicht nach Estrichbindemitteln, sondern nach der Bauweisen bzw. der Konstruktionsart unterteilt.
Verbundestrich
Der Verbundestrich wird direkt auf dem tragenden Untergrund aufgetragen und ist mit diesem kraftschlüssig verbunden. Da alle Kräfte direkt in den Untergrund abgeleitet werden, ist die Tragfähigkeit durch den Untergrund, i. d. R. eine Betondecke, bzw. durch die Druckfestigkeit des Estrichs begrenzt.
Bei einschichtigen Zement-, Calciumsulfat-, Magnesia- oder Kunstharzestrichen sollte die Nenndicke maximal 50 mm betragen. Bei Gussasphaltestrichen zwischen 20 und 40 mm. Der Untergrund sollte möglichst frei von Rissen sein. Vorbereitend ist der Untergrund gründlich zu reinigen, um eine gute Verbundwirkung zu erzielen und Hohllagen zu vermeiden. Je nach Material kann es sinnvoll sein, eine Haftbrücke, zum Beispiel aus einer Kunststoffdispersion oder -emulsion, auf die Tragschicht aufzutragen. Ebenso ist ein teilweise Strahlen oder Fräsen, und gegebenenfalls ein Vornässen der Tragschicht erforderlich. Wurden Rohrleitungen oder Kabel auf dem Untergrund verlegt, müssen diese in einen Ausgleichsestrich als Zwischenlage eingebettet werden. Auch wenn der tragende Untergrund nicht eben genug ist, ist ein ebener Ausgleichsestrich vorzusehen, auf dem anschlieÃÂend der Verbundestrich gegossen wird. Besonders bei hohen dynamischen Lasten ist ein Verbundestrich zu wählen. Es gilt die DIN 18560-3.
Estrich auf Trennlage
Eine weitere Möglichkeit einen Estrich zu konstruieren ist als Estrich auf Trennschicht. Dabei befindet sich zwischen dem tragenden Untergrund und dem Estrich eine dünne Schicht, die die Bauteile voneinander trennt. Diese Schicht besteht in der Regel aus zwei Lagen, so dass der Estrich vom tragenden Untergrund entkoppelt wird und eine spannungsfreie Bewegung möglich ist. Bei Calciumsulfat- und Gussasphaltestrich ist die Trennschicht nur einlagig auszuführen. Auch an den angrenzenden Wänden wird die Trennschicht und zusätzlich ein Trennstreifen zur Verhinderung von Einspannung verlegt. Als Material für die Trennschicht wird zum Beispiel Polyethylenfolie, kunststoffbeschichtetes Papier, bitumengetränktes Papier oder Rohglasvlies verwendet.
Die Estrichkonstruktion mit Trennschicht wird zum Beispiel bei hohen Biegebeanspruchungen in der Tragkonstruktion eingesetzt oder wenn der Tragbeton wasserabweisend ist. Um den Boden vor aufsteigender Feuchtigkeit zu schützen kann eine Abdichtung eingebaut werden, die zudem auch als eine Lage der zweilagigen Trennschicht gezählt wird.
Für eine funktionierende Konstruktion ist es wichtig, dass der tragende Untergrund eine ebene Fläche ohne unregelmäÃÂige Erhebungen oder störende Rohrleitungen ist. Das Kriechen und Schwinden und die damit einhergehenden Verformungen des Rohbetons können die Ebenheit zusätzlich beeinflussen. Das kann dazu führen, dass die Bewegung des Estrichs eingeschränkt wird und sich durch Zwangsspannungen Risse bilden. Bei einem Altbau ist das Risiko in der Regel nicht mehr gegeben, da im älteren Untergrund so gut wie keine Schwindeffekte mehr auftreten.
Für einen Estrich auf Trennschicht (DIN 18560-4) werden die erforderlichen Festigkeits- bzw. Härteklassen in der DIN EN 13813 geregelt
Schwimmender Estrich und Heizestrich auf Dämmschicht
Eine weitere Konstruktionsart ist der Estrich auf Dämmschicht. Der Estrich liegt dabei auf einer Dämmschicht auf und wird seitlich von Dämmstreifen ummantelt, so dass keine direkte Verbindung zu dem angrenzenden Untergrund und den Wänden besteht, der Estrich âÂÂschwimmtâ sozusagen. Der Estrich wird dabei auf einer wasserundurchlässigen Folie verlegt, die die Dämmschicht vor Durchfeuchten schützt und die Schallübertragung weiter abdämpft. Sind in dem Estrich oder der Dämmschicht Heizelemente eingebaut, so spricht man von einem Heizestrich.
Die Dämmschicht hat die Funktion der Trittschalldämmung oder der Wärmedämmung. Zudem ist es möglich mehrere Dämmschichtlagen einzubauen. Als Dämmschicht werden meist Dämmmatten oder -platten verwendet. Typische Materialien sind z. B. Polystyrol-Hartschaum (EPS), extrudierter Polystyrol-Hartschaum (XPS), Mineralfasern (Stein- oder Glaswolle) oder Holzweichfasern. Bei der Wahl des Dämmmaterials ist die Verformungsstabilität eine entscheidende Eigenschaft.
Aufgrund der weichen Dämmschicht kommt es immer wieder zu Schäden durch Absenkungen bei schwimmenden Estrichen. Verantwortlich können dafür zu hohe Lasten sein, die besonders in Plattenecken problematisch sind. Durch eine übermäÃÂige Last kann ein einspannender Effekt entstehen wodurch der Estrich seinen schwimmenden Charakter verliert. Besonders das Problem des sogenannten âÂÂAufschüsselnsâ ist ein wiederkehrendes Problem.
â Hauptartikel: Heizestrich
Bei einem Heizestrich gibt es verschiedene Bauarten. So können die Heizelemente innerhalb (Bauart A), unterhalb des Estrichs (Bauart B) oder in einem Ausgleichsestrich (Bauart C) angeordnet sein.
Zu beachten ist die DIN 18560-2, neben diversen Merkblättern des ZDB (Zentralverband des Deutschen Baugewerbes) und des BEB (Bundesverband Estrich und Belag). Des Weiteren müssen Messstellen für die CM-Feuchtemessung ausgewiesen werden, je Raum mindestens 2 Messstellen, und bei Räumen über 50 mò mindestens 3. Bei Heizestrichen mit mehr als 8 m Seitenlänge oder mehr als 40 mò Fläche müssen Bewegungsfugen vorgesehen werden.
Arbeitsschritte bei Verlegung von Heizestrich
Der Estrich wird vor Ort gemischt und mit einer Pumpe zur Verbrauchsstelle befördert
Druckschlauch und Auslaufbock werden zur Einbringung von Estrich benutzt
Zu erkennen ist die Folie, auf der der Estrich liegt; darunter ist die Dämmung (Polystyrol)
Abziehen (Nivellieren) mit einer langen Abziehlatte
Glättung mit Holzbrett
Fertiger Estrich, Beginn der Trocknungszeit
Trockenestrich
Unter einen Trockenestrich versteht man einen Estrich aus vorgefertigten Teilen, die auf der Baustelle kraftschlüssig miteinander verbunden werden. Daher ist er auch unter dem Namen âÂÂFertigteilestrichâ oder âÂÂTrockenunterbodenâ bekannt. Alle Trockenestriche sind nicht normativ erfasst. Es handelt sich hierbei generell um Sonderkonstruktionen, die besonders beauftragt werden müssen. Hierbei hat der Planer eine wesentlich höhere Verantwortung bzw. Planungshaftung. Es gilt die VOB/C ATV DIN 18340 âÂÂTrockenbauarbeitenâ und für Fertigteileestriche aus Holzspanplatten ist die DIN 68771 zu beachten.
Bei Trockenestrichen kommen nachfolgende Materialien zum Einsatz:
⢠Holzspanplatten (auch zement- oder magnesitgebunden)
⢠OSB-Platten, Holzfaserplatten
⢠Gipsfaserplatten, Gipskartonplatten
⢠zement- und magnesitgebundene Estrichplatten.
Bei unebenen Untergründen ist ein Ausgleich notwendig, z. B. durch eine selbstverlaufende Ausgleichsmasse oder eine Schüttung aus Tonkügelchen, Perlite, Kunststoffen oder anderen Materialien. Eine Spachtelung des Untergrunds wäre bei kleineren Unebenheiten möglich. In Nassbereichen ist die Feuchtebeständigkeit zu berücksichtigen. Es ist erforderlich die einzelnen Fertigteilplatten miteinander zu verbinden.
Verbindungsarten:
⢠Stumpf gestoÃÂen und verklebt
⢠Geklebtes Verbindungssystem mit Nut und Feder
⢠Breiter Stufenfalz, geklebt oder verschraubt mit Verklebung
⢠Zweilagige Verlegung mit versetzten Fugen, Lagen ganzflächlig verklebt, verschraubt oder durch Tackerklammern verbunden
Vor- und Nachteile von Trockenestrichen
Vorteile von Trockenestrichen:
einfache und schnelle Verlegung auch durch Laien mit geringem Geräteaufwand
keine Wartezeit durch Trocknung,
keine Feuchteprüfung und Trocknungsprotokolle,
keine Feuchtigkeitsbelastung des Baukörpers,
leichterer Aufbau, ungefähr einem Magnesitestrich entsprechend,
geringere Konstruktionshöhen als bei konventionellen Estriche,
gröÃÂere Höhendifferenzen sind durch Schüttungen ausgleichbar, dadurch geringere Gewichtsbelastung.
schnellere Reaktion bei FuÃÂbodenheizung durch geringere aufzuheizende Masse
Nachteile von Trockenestrichen:
ebener Untergrund ist erforderlich (Schüttung, Spachtelung),
die Gesamtkonstruktion muss ggf. hinsichtlich Belastbarkeit von einem Statiker bestimmt werden,
bei FuÃÂbodenheizungen sind Temperaturobergrenzen zu beachten (ebenso wie bei flüssig eingebrachtem Estrich),
mit Ausnahme von zementgebundenen Platten mehr oder weniger feuchteempfindlich
gegebenenfalls höhere Kosten bei umfangreichen Bauprojekten, da sich der für flüssig eingebrachte Estriche erforderliche Aufwand für Geräte und Einrichtung bei groÃÂen Flächen relativiert,
noch relativ junge Bauweise mit gegebenenfalls höherem Haftungsrisiko für den Planer.
Flüssig eingebrachte Estriche
Es ist vorgesehen, nach Fertigstellung eines nass eingebauten Estrichs sowohl die Dicke der Estrichlage als auch seine Feuchtigkeit an mehreren Stellen zu bestimmen. Wurde der Estrich in ungleichmäÃÂiger Dicke eingebracht, so sind aussagekräftige Messungen kaum möglich, sofern nicht bekannt ist, wo sich die stärkste und die schwächste Stelle befinden. Aufgrund der dort verzögerten Austrocknung muss der Feuchtigkeitsgehalt an der dicksten Stelle gemessen werden.[3]
Abbindeverhalten
Zementgebundener Estrich schwindet beim Abbinden.
In der Norm ist vorgesehen, dass ab einer bestimmten GröÃÂe der Estrichfläche sowie an Einschnürungen und Innenecken Dehnungsfugen vorzusehen sind.
Aufgrund des Feuchtegradienten im abtrocknenden Estrichs schwindet dieser an der Oberfläche stärker als unten und es kommt bei Estrichen auf Trennlage zu einer Aufschüsselung, die sich vor allem an Rändern und gegebenenfalls vorhandenen Bewegungs- und Arbeitsfugen bemerkbar macht, da die Verformung im mittleren Bereich durch das Eigengewicht behindert wird.
Dämmschichten erlauben es dem Estrich, mittig einzusinken, so dass sich die Aufwölbung der Ränder weniger bemerkbar macht. Bei auf Folie verlegten Estrichen kann es an den Rändern zur Hohllage kommen.[3]
Belegereife
Eine Definition der Belegreife lautet: âÂÂDie Belegreife ist der erreichte Zustand eines Estrichs in Bezug auf Abbinde- und Trocknungsreaktionen, in dem er für die schadens- und mangelfreie, dauerhafte Aufnahme eines Belags geeignet ist.â Dazu werden drei wesentliche zeitabhängige Parameter genannt:
⢠Ausreichende Trocknung
⢠Ausreichende Festigkeit
⢠Ausreichender Schwindungsabbau
ÃÂblicherweise wird die Belegreife aber nur an der ausreichenden Trocknung festgemacht, dazu wird die CM-Messung verwendet. Ein Estrich muss die sogenannte Gleichgewichtsfeuchte erreicht haben damit er als belegreif gilt. Das bedeutet, dass sein Wassergehalt im Gleichgewicht mit der umgebenden Raumluft steht. Für Naturstein und Keramik ist zudem auch die Verformungsstabilität entscheidend, während bei Parkett bzw. Weichboden, wie PVC, Linoleum oder Kautschuk die Feuchtigkeit ausschlaggebend ist.
Für den Natursteinbereich bedeutet es, dass die zu erwartende Schwindung des Estrichs so weit wie möglich abgeschlossen sein muss. Bei zu hoher Raumtemperatur oder eingeschalteter FuÃÂbodenheizung wirkt der Estrich zwar trocken, ist aber noch lange nicht belegreif. Für die mit Wasser angemischten Estrichmörtel sind ausreichend lange Trocknungszeiten (inkl. Aushärtung) einzuhalten.
Je nach Luftwechsel, Raumtemperatur, relativer und absoluter Luftfeuchte kann sich diese Zeit erheblich verlängern. Die Werte für die zulässige Restfeuchte bis zur Belegreife sind abhängig von der Estrichart, von der unbeheizten oder beheizten Konstruktion und von der späteren Belagsart. Eine Zwangstrocknung kann zu einer unterbrochenen Hydratation führen und bei späterem Feuchteeintrag (Mörtel des Oberbelags) Verformungen mit Rissbildung hervorrufen. Die Richtwerte für den Feuchtegehalt bei Belegreife nach der CM-Methode betragen für beheizte Zementestriche 1,8 CM-% (bei unbeheizt 2 CM-%). Wenn der gemessene Wert den Richtwert unterschreitet ist der Estrich belegreif.
Bei Calciumsulfatestrichen ist eine erhöhte Trockenheit notwendig. Der Richtwert liegt bei 0,3 CM-% (bei unbeheizt 0,5 CM-%). AuÃÂerdem sind Calciumsulfatestriche vor aufsteigender Feuchtigkeit oder Wasserdampfdiffusion mit Dampfsperren und Abdichtungen zu schützen.
Die angegebenen Werte entsprechen CM-%. Diese Werte werden mit einem Calciumcarbid-Messgerät (CM-Gerät) ermittelt. Die CM-Messung ist normativ vorgeschrieben. Dabei wird eine kleine Menge Estrich aus dem vorhandenen Estrich entnommen, zerkleinert und unter Zugabe von Calciumcarbid in einer Stahldruckflasche aufgeschüttelt. Das Calciumcarbid reagiert unter Druckanstieg mit dem Restwasser zu dem Gas Ethin (Acetylen). Der Druck wird mittels Manometer gemessen und kann mit einer Eichtabelle auf CM-% umgerechnet werden. Mit Zusätzen, die so genannte âÂÂschnell trocknende Estricheâ enthalten, kann die Belegreife ggf. verkürzt werden. Diese Schnellestriche sind keine normgerechten Estriche, sondern Sonderkonstruktionen. Sie sind daher mit Vorsicht zu benutzen, weil teilweise keine sicheren Aussagen über die Belegreife gemacht werden können, es muss sich auf die Angaben des Herstellers verlassen werden.
Normen
Die geltenden Normen für Estriche sind innerhalb der EU:
DIN EN 13318 Estrichmörtel und Estrich-Begriffe
DIN EN 13813 Estrichmörtel und Estrichmassen â Eigenschaften und Anforderungen
DIN EN 13892 Prüfverfahren für Estrichmörtel und Estrichmassen, Teil 1 bis 8
Zusätzlich gilt in Deutschland:
DIN 18560 Estriche im Bauwesen, deutsche Anwendungsregeln
Teil 1: Allgemeine Anforderungen, Prüfung und Anwendungsregeln
Teil 2: Estrich und Heizestriche auf Dämmschichten
Teil 3: Verbundestriche
Teil 4: Estriche auf Trennschicht
Teil 7: Hochbeanspruchte Estriche (Industrieestriche)
Konformitätskontrolle
Die Konformitätskontrolle bei normativ erfassten werkgefertigten Estrichen umfasst die Erstprüfung und eine werkseigene Produktionskontrolle bzw. Eigenüberwachung.
Eine Erstprüfung muss bei Produktionsbeginn des Estrichs bzw. vor der Herstellung eines jeweils neuen Produktes oder aber bei Veränderungen von Reaktanten durchgeführt werden. Auch eine Veränderung und eine Umstellung des Herstellverfahrens erfordern eine jeweilige Erstprüfung. Die erforderlichen Prüfungen für die jeweilige Estrichtart ist in der DIN EN 13813 geregelt.
Bei sogenannten Baustellenestrichen erfolgen eine Prüfung der Lieferscheine sowie eine Sichtprüfung der Edukte. Der Herstellungsvorgang als solcher muss in regelmäÃÂigen Abständen kontrolliert werden. In Ausnahmefällen kann eine Erhärtungsprüfung anfallen und in Sonderfällen, wenn erhebliche Zweifel an der Güte des Estrichs im Bauwerk bestehen, kann auch eine Bestätigungsprüfung notwendig sein
Weblinks
Wiktionary: Estrich â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Bundesverband Estrich und Belag e. V.
Verband der österreichischen Estrichleger
Infoline-FuÃÂboden â Online-Lexikon
bga â Beratungsstelle für Gussasphaltanwendung e. V.
Einzelnachweise
â DIN EN 13318: Estrichmörtel und Estriche â Begriffe.
â Brokamp / Trettin: Belegereife und Feuchte, TKB-Bericht 1
â a b Ralf Marth: Technik – Experten erklären: Estriche auf Trennlage, Heftarchiv der Zeitschrift bodenwanddecke, 12. März 2015. In: Boden-Wand-Decke.de
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4015590-0 (OGND, AKS)
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Estrich&oldid=209112089âÂÂ
Kategorie: Estrich
Navigationsmenü
firmenmantel kaufen gmbh grundstück kaufen
Top 6 Businessplan:
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Charter (Begriffsklärung) aufgeführt.
Die Charter (englisch âÂÂFrachtvertragâÂÂ) ist ein Anglizismus für die befristete ÃÂberlassung eines Gegenstandes gegen die Entrichtung eines Nutzungsentgelts.
Inhaltsverzeichnis
1 Allgemeines
2 Arten
2.1 Inhalt und Umfang
2.2 Transportmittel
3 Rechtsfragen
4 International
5 Weblinks
6 Einzelnachweise
Allgemeines
Das Wort Charter ist international begrenzt auf die Transportmittel der Flugzeuge und Schiffe[1] und wird meist als die Abkürzung für den Charterverkehr oder Chartervertrag verwendet. Chartern ist das Mieten oder Pachten von Flugzeugen oder Schiffen.[2]
Die Charter bezweckt mithin, dass bestimmte Transportmittel für einen bestimmten Zeitraum von anderen als den Eigentümern genutzt werden sollen. Geht es um das Chartern von Segel- und Motorbooten für Urlaub oder Regatten, bezeichnet man dies gemeinhin als Yachtcharter.
Arten
Zu unterscheiden ist nach Inhalt und Umfang sowie nach dem eingesetzten Transportmittel:
Inhalt und Umfang
Bei Vollcharter wird die gesamte Kapazität des Transportmittels, bei Teilcharter (oder Raumcharter) nur ein Teil der Kapazität für den Transport mit Personal gemietet oder gepachtet.[3] Das gilt für sämtliche Transportwege zu Wasser und in der Luft.
Transportmittel
Je nach Transportmittel gibt es den Charterflug oder die Schiffscharter.
Flugzeugcharter
Reiseveranstalter nutzen Sitzplatzkontingente (Teilcharter) bei Fluggesellschaften oder ganze Flugzeuge (Vollcharter) für Flugreisen.
Schiffscharter
Im internationalen Seeverkehr werden folgende Charterarten unterschieden:[4]
Bareboat-Charter
Es wird das unbemannte Schiff für eine einzelne Reise oder einen definierten Zeitraum dem Charterer überlassen. Der Charterer hat selbst für die Bereederung zu sorgen und trägt während des Nutzungszeitraumes die Kosten für Wartung, Reparaturen und Betriebsstoffe. International üblich wird eine Bareboat-Charter[5] in US$ pro Kalendertag vereinbart und berechnet. Kann das Schiff während dieser Zeit z. B. aufgrund eines technischen Defekts nicht genutzt werden, hat der Charter dieses Risiko zu tragen.
Bareboat-Charter spielt eine wichtige Rolle bei der Ausflaggung, da diese Form unter Anwendung des ç 7 FlaggRG ermöglicht, unter fremder Flagge zu fahren, ohne das deutsche Schiffsregister zu verlassen. So waren im Juli 2011 3166 Schiffe mit 67.994.048 BRZ vorübergehend ausgeflaggt. Nach Anzahl der Schiffe waren die beliebtesten fremden Flaggen Liberia sowie Antigua und Barbuda mit 1194 bzw. 1086 Fahrzeugen. Liberia führte dabei nach Tonnage mit 40.432.091 BRZ die Liste mit weitem Abstand an.[6] Der Bareboat-Charterer wird Ausrüster genannt, wenn er das gecharterte Schiff mit Treibstoff, Proviant, Trinkwasser sowie technischem Schiffsbedarf ausrüstet und mit einer eigenen Besatzung inklusive eines Kapitäns betreibt. Vereinbart der Bareboat Charterer jedoch eine âÂÂmanagement agreementâÂÂ-Klausel, in der dem Eigner des Schiffes die Ausrüstung inklusive Reparaturen und die Besatzung inklusive eines Kapitäns übertragen wird (englisch to demise), so wird er Demise Charterer genannt.[7]
Reisecharter (englisch Voyage Charter)
Im Gegensatz zur Zeitcharter stellt der Schiffseigentümer dem Charterer das Schiff für eine bestimmte Reise und nicht für einen entsprechenden Zeitraum zur Verfügung. Der Charterbetrag wird deshalb nicht nach Zeit, sondern nach der Ladung berechnet. In der Regel gibt es für die Lade- und/oder Entladezeit (englisch laytime) einen festgelegten Zeitraum, der nach Stunden oder Tagen bestimmt ist. Wird dieser Zeitraum überschritten, beginnt die ÃÂberliegezeit (englisch Demurrage). Hierfür ist im Chartervertrag regelmäÃÂig eine feste Rate pro Stunde oder Tag zusätzlich zu zahlen. Im umgekehrten Fall kann der Schiffseigentümer dem Charterer einen bestimmten Betrag zahlen, wenn der Charterer unterhalb der laytime bleibt (englisch dispatch); häufig ist das die Hälfte des Demurrage-Betrages. Das Risiko für Verspätungen trägt hier der Schiffseigentümer.
Kreuzfahrten sind ein typischer Fall des Reisecharters.
Zeitcharter (englisch Time Charter)
Der Schiffseigentümer (Reeder) stellt das betriebsbereite, ladefähige und bemannte Schiff dem Charterer für einen definierten Zeitraum zur Verfügung. International üblich wird eine Zeitcharter[8] in US$ pro Nutzungstag vereinbart und berechnet. Der Charterer zahlt neben der vereinbarten Charter auch den benötigten Treibstoff sowie die Kosten für Hafenanläufe, Kanalpassagen u. ä. Der Eigentümer bleibt für den technischen Zustand des Schiffes verantwortlich und hat das Schiff während des Zeitraumes instand zu halten. Er kann die Bereederung selbst ausführen oder einem Dritten übertragen, dem sogenannten Vertragsreeder. Kann das Schiff während des Nutzungszeitraumes z. B. aufgrund einer Dockung oder eines technischen Defekts nicht genutzt werden, wird das Schiff off-hire gestellt, d. h. der Charterer zahlt für diesen Zeitraum keine Charter. Bei dieser Art eines Charters ist das Risiko von Verspätungen auf Seiten des Charterers.
Rechtsfragen
Rechtsgrundlage des Charters ist ein Chartervertrag, der zwischen dem Verfrachter und dem Befrachter geschlossen wird. Die Einordnung des Chartervertrags in die Vertragstypen des deutschen Schuldrechts bereitet wegen der zahlreichen unterschiedlichen Ausgestaltungen Schwierigkeiten. Umstritten ist, ob die Charter ein Beförderungsvertrag, also Werkvertrag, oder aber Miete sei.[9] Beim Chartervertrag handelt es sich um einen Vertrag zur zeitlich begrenzten Schiffsüberlassung, welcher dem Mietvertrag ähnelt.[10] In der Regel handelt es sich um einen Dienstvertrag und nicht um einen Werkvertrag. Wird das gesamte Schiff oder Flugzeug für eine bestimmte Zeit vollständig dem Charterer ohne Besatzung zur Benutzung überlassen, so liegt ein Mietvertrag vor. Ist aufgrund einer Employment-Klausel auch die ÃÂberlassung der Mannschaft geschuldet, so kommen in der Regel die Vorschriften des Transportrechts zur Anwendung. ÃÂberlässt der Vercharterer (z. B. die Fluggesellschaft) nur ein Kontingent an Plätzen für Passagiere (z. B. an einen Reiseveranstalter), so liegt ein Werkvertrag mit der Pflicht zur Sammelbeförderung nahe. Vertragsgegenstand des Beförderungsvertrages ist stets die Ladung, bei der Charter aber das Schiff.[11]
Der Verfrachter ist Eigentümer des Transportmittels oder berechtigt, für dessen Eigentümer (beispielsweise Reederei) zu handeln. Das Handelsgesetzbuch (HGB) erwähnt im Seehandelsrecht in ç 557 HGB lediglich den Zeitcharter, der den âÂÂZeitverchartererâ verpflichtet, dem âÂÂZeitchartererâ zu dessen Verwendung ein bestimmtes Seeschiff mit Schiffsbesatzung auf Zeit zu überlassen und mit diesem Schiff Güter oder Personen zu befördern oder andere vereinbarte Leistungen zu erbringen. Ansonsten erwähnen Gesetze den Charter nicht. Das Personenbeförderungsgesetz (PBefG) spricht vielmehr in ç 46 PBefG von verschiedenen Fahrtzwecken mit Kraftfahrzeugen, die nicht Linienverkehr darstellen, vom Gelegenheitsverkehr.
Deshalb gibt es den Chartervertrag als Vertragstyp nur im Gelegenheitsverkehr und bei Seeschiffen, so dass bei allen übrigen Transportmitteln Miet- oder Pachtrecht gilt.
International
Durch den Chartervertrag verpflichtet sich in der Schweiz der Reeder als Verfrachter, den Raumgehalt eines bestimmten Seeschiffes ganz oder teilweise für eine bestimmte Zeit (Zeitcharter) oder für eine oder mehrere bestimmte Seereisen (Reisecharter) dem Befrachter zur Verfügung zu stellen, und der Befrachter zur Leistung einer Vergütung (Art. 94 Abs. 1 Seeschifffahrtsgesetz-SSG). Verfrachter und Befrachter können verlangen, dass über den Vertrag eine schriftliche Urkunde (Charter-Partie) ausgestellt wird (Art. 94 Abs. 2 SSG). GemäàArt. 100 Abs. 2 SSG bestimmt der Verfrachter den Reiseweg zwischen Lade- und Löschplatz.
In ÃÂsterreich bezieht sich gemäàç 556 UGB der Frachtvertrag zur Beförderung von Gütern entweder auf das Schiff im ganzen oder einen verhältnismäÃÂigen Teil oder einen bestimmt bezeichneten Raum des Schiffes oder auf einzelne Güter (Stückgüter). Jede Vertragspartei kann nach ç 557 UGB verlangen, dass über den Vertrag eine schriftliche Urkunde (Chartepartie) errichtet wird.
Weblinks
Wiktionary: Charter â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Einzelnachweise
â Gerd W. Goede, Dictionary of International Trade, 1996, S. 82
â Verlag Dr. Th. Gabler (Hrsg.), Gablers Wirtschafts-Lexikon, Band 2, 1984, S. 925
â Georg Walldorf (Hrsg.), Gabler Lexikon Auslands-Geschäfte, 2000, S. 112
â Ulrich Stahl, Das IPR der Charterverträge (Reise-, Zeit- und Bareboat-Charter), in: Zeitschrift âÂÂTransportrechtâ (TranspR), 2010, S. 258
â Im deutschen Seehandelsrecht ist der Bareboat-Charter als Schiffsmiete mit Wirkung seit dem 25. April 2013 nunmehr in den çç 553 ff. des deutschen Handelsgesetzbuches geregelt.
â Archivierte Kopie (Memento des Originals vom 5. Mai 2012 im Internet Archive) Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäàAnleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.bsh.de (PDF)
â Verband Deutscher Reeder (Hrsg.): Güterverkehr über See. Stern Verlag, Lüneburg 1993, ISBN 3-923603-00-2.
â Im deutschen Seehandelsrecht ist die Zeitcharter mit Wirkung seit dem 25. April 2013 nunmehr in den çç 557 ff. des deutschen Handelsgesetzbuches geregelt.
â Hans-Jürgen Puttfarken, Seehandelsrecht, 1997, Rz. 398
â Andreas Maurer, Lex Maritima: Grundzüge eines transnationalen Seehandelsrechts, 2012, S. 49
â Hans-Jürgen Puttfarken, Seehandelsrecht, 1997, Rz. 331
Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten!
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Charter&oldid=204900289âÂÂ
Kategorien: TourismusVerkehrsrechtHandelsrechtTransportrechtSeerechtReiserechtSchuldrecht (Deutschland)UnternehmensartVersteckte Kategorie: Wikipedia:Defekte Weblinks/Ungeprüfte Archivlinks 2019-03
Navigationsmenü
gmbh gmbh mantel kaufen schweiz
Unternehmensberatung gmbh kaufen 34c
car sharing leasing büromöbel leasing
Top 6 Bilanz:
Diese Seite enthält momentan noch keinen Text und du bist auch nicht dazu berechtigt, diese Seite zu erstellen.
Du kannst ihren Titel auf anderen Seiten suchen oder die zugehörigen Logbücher betrachten.
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/wiki/VereineâÂÂ
Navigationsmenü
gmbh mit steuernummer kaufen Vorratsgmbhs
gmbh kaufen wien AG
computer leasing gmbh kaufen vorteile
Top 3 loi:
Verkauf (Verb: verkaufen) bezeichnet:
im rechtlichen Sinne die ÃÂbertragung einer Sache oder eines Rechts gegen Entgelt, siehe ÃÂbereignung
speziell der bestimmte Rechtsbegriff der VeräuÃÂerung
ein wirtschaftlicher Vorgang, siehe Vertrieb
ein Instrument der Kommunikationspolitik, siehe Persönlicher Verkauf
Verkauf ist der Familienname von:
Leo Verkauf (1858âÂÂ1933), österreichisch-galizischer Anwalt, Fachautor und Parlamentarier
Willy Verkauf (1917âÂÂ1994), schweizerisch-israelisch-österreichischer Lebenskünstler
Siehe auch:
Kauf
Handel (Begriffsklärung)
Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel mit Verkauf beginnt
Liste aller Wikipedia-Artikel, deren Titel Verkauf enthält
Wiktionary: Verkauf â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Wiktionary: verkaufen â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Wikiquote: Verkauf â Zitate
Dies ist eine Begriffsklärungsseite zur Unterscheidung mehrerer mit demselben Wort bezeichneter Begriffe.
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Verkauf&oldid=194923393âÂÂ
Kategorie: Begriffsklärung
Navigationsmenü
firmenmantel kaufen gesellschaft kaufen was ist zu beachten
GmbH gründen gmbh gründen haus kaufen
Top 10 verkaufsbedingungen:
Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Schiffstyp. Zum gleichnamigen Segelmagazin siehe Yacht (Zeitschrift).
Segelyacht mit Dingi im Schlepp
Motoryacht Azzam
Eine Yacht legt im Hafen von Saint-Tropez an
Kuriosum: Paul Allens Luxusyacht Tatoosh mit eigener Segelyacht als Beiboot auf der Backbord-Seite
Eine Yacht beziehungsweise Jacht[1] (aus gleichbedeutend niederländisch jacht, dies verkürzt aus mittelniederdeutsch jachtschip âÂÂJagdschiffâÂÂ, âÂÂschnelles SchiffâÂÂ) ist (heute) ein Wasserfahrzeug für Sport- und/oder Freizeitzwecke, das â von Sonderfällen abgesehen â mit einem Deck und einer Kajüte ausgestattet ist. Entsprechend der Antriebsart werden Motoryachten und Segelyachten unterschieden. Wesentlich für eine Segelyacht ist â in Abgrenzung zur Jolle â ein fester, in der Regel mit Ballast versehener Kiel.
Inhaltsverzeichnis
1 Begriff
2 Bauart und Ausstattung
3 Besatzung
4 Technische Daten
5 Geschichte
6 Bekannte Yachten
7 Siehe auch
8 Literatur
9 Weblinks
10 Einzelnachweise
Begriff
Im Alltagsgebrauch wird üblicherweise erst ab einer gewissen Länge des Fahrzeugs von einer Yacht gesprochen. Unter etwa 7 m spricht man eher von einem Boot, über 10 m von einer Yacht. Eine typische Yacht in europäischen Küstengewässern ist heute um die 10 bis 17 Meter lang (30 bis 56 FuÃÂ) und mit mehreren Kabinen ausgestattet. Auf deutschen Binnenseen herrschen bei Yachten Bootslängen von 6 bis 15 Meter vor.
GröÃÂere Yachten werden auch als Maxiyachten bezeichnet, je nach GröÃÂe als Mini-Maxis, Maxis oder Supermaxis. Die Grenzen zwischen diesen Kategorien sind keineswegs fest, als Anhaltspunkt kann aber beispielsweise die Klasseneinteilung des Yacht Club Costa Smeralda dienen, der bei seinen Regatten Yachten von 18âÂÂ24 m als Mini-Maxis, Yachten über 30,5 m als Supermaxis und alle dazwischen als Maxis starten lässt.[2]
Sehr groÃÂe Yachten, bei denen kein Wert auf sportliche Nutzung gelegt wird, sondern die als reine Luxusobjekte dienen, werden als Megayachten oder Superyachten bezeichnet.
Bauart und Ausstattung
ÃÂbliche Baumaterialien für Yachten sind heute faserverstärkte Kunststoffe (meist GFK oder CFK). Holz war früher der einzig verfügbare Baustoff, wurde aber von Kunststoffen praktisch vollständig abgelöst. Stahl und Aluminium werden sehr selten verwendet. Beton (Ferrozement) wurde in den 1970er Jahren erprobt, konnte sich aber nie durchsetzen. Der Bau einer modernen Yacht ist eine sehr komplexe und anspruchsvolle Arbeit, die viel Erfahrung erfordert.
Bei Maxi- und Megayachten spielt Komfort eine groÃÂe Rolle, sie ähneln eher privaten Kreuzfahrtschiffen als Sportbooten.
Bauart, Einrichtung, Motorisierung und Ausrüstung einer Yacht richten sich sehr nach dem bevorzugten Revier und der Stärke der Nutzung. Yachten, die in der EU in Betrieb genommen werden, müssen der CE-Norm entsprechen und gemäàihrer Konstruktion und Ausrüstung in eine der Kategorien A bis D eingeordnet werden.
Besatzung
In der Regel befinden sich Yachten, egal ob Motor- oder Segelyachten, ab einer Rumpflänge von 21 Metern (70 FuÃÂ) in der Verantwortung von semi- oder vollprofessionellen Besatzungen (Yachtmatrose). Ab zwei Personen spricht man von einer Crew, dabei handelt es sich zumeist um Schiffsführer (âÂÂSkipperâÂÂ) und Steward. Der Anzahl der Crewmitglieder sind mit steigender GröÃÂe der Yacht kaum Grenzen gesetzt â sie kann bei Megayachten mehr als 60 Personen umfassen, darunter z. B. Köche und Ingenieure. Der Skipper ist dann oft Kapitän mit Patent für groÃÂe Fahrt.
Insbesondere wegen der hohen Personalkosten ist die Charter von Yachten zu einer beliebten Alternative zur eigenen Yacht geworden. Damit können auch weitere Nachteile einer eigenen Yacht vermieden werden (Anschaffungskosten, Distanz zum Liegeplatz, Klima- und Revierabhängigkeit).
Technische Daten
Die gröÃÂten Privatyachten erreichen über 180 Meter Länge. Sie können 20âÂÂ36 Knoten erreichen.[3]
Die breite Masse fährt eher Yachten mit einer Länge zwischen 10 und 20 Metern. Segelyachten sind ab etwa 12 Metern sicher hochseetauglich, Motoryachten wegen der geringeren Stabilität erst deutlich darüber. Zudem begrenzt der Treibstoffvorrat einer âÂÂnormalenâ Motoryacht von zwischen 500 und 1.500 Litern die Reichweite, denn 100 Liter pro Stunde können auch hier verbraucht werden. Die Reichweite einer Segelyacht ist nicht durch den Treibstoff begrenzt und ihre Höchstgeschwindigkeit wird durch die Rumpfgeschwindigkeit bestimmt.
Geschichte
Eine mit barocken Verzierungen versehene Speeljacht aus der Mitte des 17. Jahrhunderts (Gemälde von Willem van de Velde dem ÃÂlteren)
Eine Herenjacht als Dienstfahrzeug der VOC von 1790
Es sind in der Vergangenheit viele Schiffsformen als Jachten bezeichnet worden. Neben kleinen dreimastigen Jagten mit Spiegelheck um 1600 wurden in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts auch speziell für Lustfahrten mit einer Frühform des Hochsegels versehene Schiffe für Binnen- und Küstengewässer so genannt. Im weiteren Verlauf des 17. Jahrhunderts wurde der Begriff Jacht eher für administrative und herrschaftliche Fahrzeuge verwendet. Diese sind als Statenjacht oder Herenjacht bekannt. Die Schenkung zweier solcher Jachten an den englischen Hof markiert den Beginn der Nutzung dieser Form in England als Yacht. In Dänemark wurde im Laufe des späten 17. Jahrhunderts eine Frachtschiffform mit dieser Bezeichnung entwickelt. Es handelte sich um einen schnellen Segler mit scharfer Spantform bei runderem Bug, schmalerem Heck und einmastiger Gaffeltakelage mit Topprahen. Diese Form wurde noch im ganzen 19. Jahrhundert in Dänemark und Norddeutschland gebaut.
Bekannte Yachten
Germania, erste Krupp-Yacht von 1908
Hohenzollern, Staatsyacht Kaiser Wilhelms II.
Anita, klassische 12 mR-Yacht von 1938,
Britannia, die 83. und vorerst letzte königliche Yacht des britischen Monarchen, 1954âÂÂ1997 im Dienst
Illbruck, deutsche Yacht, 2001/2002 Siegerin des Volvo Ocean Race
Alinghi, Schweizer Yacht, 2003 und 2007 Siegerin des AmericaâÂÂs Cup
Eclipse, Yacht des Milliardärs Abramowitsch, mit 163 Metern die zweitlängste Privatyacht[3]
Azzam, mit einer Länge von 180 Meter die längste private Yacht der Welt
Sailing Yacht A, mit einer Länge von 142 Metern die längste Segelyacht der Welt.
Siehe auch
Liste der längsten Motoryachten
Liste der längsten Segelyachten
Literatur
Bücher
Deutscher Hochseesportverband Hansa, Fridtjof Gunkel (Hrsg.): Seemannschaft. 27. Auflage. Delius Klasing, Bielefeld 2005, ISBN 3-7688-0523-9.
Volker W. Christmann: Segelsport-Bibliographie. V. W. T. Christmann, Wiesbaden 1999, ISBN 3-00-004437-X.
Daniel Charles: Die Geschichte des Yachtsports. Delius Klasing, Bielefeld 2002, ISBN 3-7688-1300-2.
Detlef Jens: Die klassischen Yachten. 4 Bände, Koehlers Verlagsgesellschaft, Hamburg.
Bd. 1: Festivals in Nordeuropa. 2006, ISBN 978-3-7822-0943-4.
Bd. 2: Die Kunststoffrevolution. 2007, ISBN 978-3-7822-0945-8.
Bd. 3: Rennschiffe im Wandel der Zeit. 2007, ISBN 978-3-7822-0958-8.
Bd. 4: Die Fahrtenyachten. 2010, ISBN 978-3-7822-0969-4.
Hans Szymanski: Deutsche Segelschiffe. Die Geschichte der hölzernen Frachtsegler an der deutschen Ost- u. Nordseeküste, vom Ende des. 18. Jahrhunderts bis auf die Gegenwart (Veröffentlichungen des Instituts für Meereskunde an d. Universität Berlin, B., Historisch-volkswirtschaftliche Reihe, H. 10). Mittler, Berlin 1934.
Werner Jaeger: Die niederländische Jacht im 17. Jahrhundert. Eine technisch-historische Dokumentation. Verlag für Regionalgeschichte, Bielefeld 2001, ISBN 3-89534-415-X.
Svante Domizlaff, Alexander Rost: GERMANIA Die Yachten des Hauses Krupp. Delius Klasing Verlag, Bielefeld 2006, ISBN 3-7688-1840-3, ISBN 978-3-7688-1840-7.
Zeitschriften und Magazine
palstek â Technisches Magazin für Segler; Palstek-Verlag Hamburg. ISSN 0936-5877
Skipper, Freizeit+Wassersport Verlag, Miesbach. ISSN 0721-4472
Yachtrevue, Hrsg.: ÃÂsterreichischer Segelverband, Neusiedl. ISSN 1013-7823
Yacht, Delius-Klasing-Verlag, Bielefeld. ISSN 0043-9932
Yacht Spezial classic, Delius-Klasing-Verlag, Bielefeld
Boote Exklusiv
Meer & Yachten
Boat International (englisch)
Power and Motoryacht Magazine (englisch)
Weblinks
Wiktionary: Yacht â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Commons: Yachten â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Yachtsportarchiv, Freundeskreis klassischer Yachten
Einzelnachweise
â Siehe Wörterverzeichnis des amtlichen Rechtschreibregelwerks.
â Yacht Club Costa Smeralda â Sporting Calendar 2012 (Memento vom 21. September 2012 im Internet Archive), abgerufen am 9. Sept. 2012
â a b https://www.welt.de/motor/boote-yachten/article108944439/Abramowitsch-Sein-Arzt-seine-Kicker-sein-Boot.html
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4067159-8 (OGND, AKS)
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Yacht&oldid=207290596âÂÂ
Kategorie: Yacht
Navigationsmenü
Meine Werkzeuge
gmbh zu kaufen FORATIS
gesellschaft kaufen mantel car sharing leasing
gmbh mantel kaufen österreich preisvergleich GmbH Kauf
Top 8 darlehensvertrag:
Büro-Service, auch Office-Service oder Sekretariatsservice genannt, ist die Dienstleistung eines Unternehmens, für andere Unternehmen Büroarbeiten zu übernehmen, insbesondere typische Tätigkeiten eines Sekretärs.
Inhaltsverzeichnis
1 Service
2 Vorteile
3 Siehe auch
4 Einzelnachweise
Service
ÃÂber die Leistungen eines Schreibbüros hinausgehend wird zumindest Telefonservice angeboten. Das Angebot kann über allgemeine Bürotätigkeiten wie Korrespondenz und andere Kommunikation hinaus Leistungen bis hin zur Buchführung umfassen.
Sofern die Dienstleistung nicht in Räumen des Kunden erbracht wird, wird sie auch als Virtual Office bezeichnet, also als virtuelles Büro des Kunden. Der Begriff geht wohl auf Chris Kern zurück, der ihn 1983 in einer Zeitschrift erstmals verwendet haben will.[1]
Dabei können insbesondere zwei Arten von Büro-Service unterschieden werden:
Zum einen die Bereitstellung einer Geschäftsadresse (Domizil-Service) in meist exklusiven Stadtlagen. Unter dieser Geschäftsadresse werden die anfallende Korrespondenz abgewickelt und auch Besprechungsräume bereitgestellt. Hierbei werden vom Auftragnehmer also eher repräsentative Funktionen übernommen.
Spezialisierte Büroservice Unternehmen bieten unterschiedlich groÃÂe Büroflächen mit der entsprechenden Infrastruktur wie Büromöbel, Telekommunikations- und Internetanschlüsse an. Die Vermietung der kleinen Büroeinheiten erfolgt für Stunden, Monate oder Jahre.
Zum anderen Outsourcing von Bürotätigkeiten, die vom Auftraggeber bisher selbst erledigt wurden.
Weitere Dienstleistungen können z. B. gemeinschaftlich (mit anderen Mietern) genutzte Meetingräume oder Technikräume sein.
Die meisten Anbieter von virtuellen Büros befinden sich in GroÃÂstädten, wo oftmals die Mieten für Büros hoch sind, aber das Prestige einer Geschäftsadresse zählt, wie in New York, London, Hongkong, Berlin, Frankfurt, Düsseldorf.
Vorteile
Vor allem in wirtschaftlich schlechten Zeiten ist die Inanspruchnahme eines Büro-Services von groÃÂem Vorteil: Kosten fallen nur für tatsächlich erbrachte Leistungen an. Fixkosten werden somit minimiert und das Unternehmen bleibt flexibel. Somit kann ein Unternehmer in Spitzenzeiten gewisse Aufgaben an einen Anbieter eines Büro-Services auslagern. Gewissenhafte und seriöse Anbieter stellen gewisse Anforderungen an Ihre Kunden (Stichwort Postadresse). Somit wird versucht, unseriöse âÂÂBriefkasten-Firmenâ auszusondern.
Siehe auch
Business Center/Office Center
Einzelnachweise
â My Word!. Chris Kern. Abgerufen am 10. Oktober 2009.
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Büroservice&oldid=198188131âÂÂ
Kategorien: DienstleistungssektorBüroDienstleistung
Navigationsmenü
gmbh kaufen mit arbeitnehmerüberlassung gmbh-mantel kaufen gesucht
gmbh mit verlustvorträgen kaufen Gesellschaftskauf
firmenmantel kaufen büromöbel leasing
Top 7 verkaufsbedingungen:

Zur Suche springen
US-amerikanischer Zahnarzt (2004)
Zahnarzt in der DDR (1978)
âÂÂDer Zahnarztâ (Gemälde 1622) von Gerrit van Honthorst
Zahnbrecher (Darstellung um 1568)
Dieser Artikel oder Absatz stellt die Situation in Deutschland dar. Hilf mit, die Situation in anderen Staaten zu schildern.
Zahnarzt ist die Berufsbezeichnung für einen Absolventen des Studiums der Zahnmedizin. Die Ausübung des Berufs ist in Deutschland nur aufgrund einer gültigen Berufszulassung (Approbation oder Berufserlaubnis) zulässig. Approbationen ermächtigen zur selbstständigen Berufsausübung in der Bundesrepublik Deutschland. Berufserlaubnisse können nur zeitlich und örtlich befristet erteilt werden. Im Gebiet der ehemaligen DDR werden die Zahnärzte auch Stomatologen genannt. Das Studium der Stomatologie wurde zeitweise mit einer Facharztprüfung (Facharzt für allgemeine Stomatologie) und später mit dem Diplom abgeschlossen (Dipl.-Stom. = Diplom-Stomatologe). Die aus der Gruppe der nichtapprobierten Zahnbehandler hervorgegangene Berufsbezeichnung Dentist ist veraltet und bezeichnete bis 1952 fortgebildete Zahntechniker, die in begrenztem Umfang Zahnheilkunde ausüben durften. Der Zahnarzt gehört in Deutschland zu den Freien Berufen, ebenso wie in ÃÂsterreich.
Das Tätigkeitsfeld eines Zahnarztes beinhaltet Prävention, Diagnose und Therapie von Zahn-, Mund- und Kiefererkrankungen. Ebenfalls werden Patienten mit anerkannten stomatologischen Berufskrankheiten (Abrasio dentium) und Arbeitsunfällen auf Kosten der Berufsgenossenschaft behandelt.
Es gibt rund 112.000 Zahnärzte in Deutschland, davon ca. 53.000 Vertragszahnärzte. Rund 17.500 sind in Praxen tätige Assistenten, Vertreter, angestellte Zahnärzte und auÃÂerhalb von Praxen zahnärztlich tätige Mitglieder. Weitere ca. 20.600 sind ohne zahnärztliche Tätigkeit (Stand: 2014).[1] Die Anzahl der Zahnärzte in sozialversicherungspflichtigen Beschäftigungen ist von 2005 bis 2011 von 4676 auf 8060 und damit um 72 % gestiegen.[2]
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Ausbildung
3 Approbation
4 Weiterbildung
4.1 Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
4.2 Fachzahnarzt für Oralchirurgie
4.3 Mund- Kiefer- Gesichtschirurg
4.4 ÃÂffentliches Gesundheitswesen
5 Master
6 Fortbildung
7 Niederlassung
8 Zulassung
9 Einkommen
9.1 Angestellte Zahnärzte
9.2 Zahnärztliche Praxisinhaber
10 Berufsrecht
11 Heilpraktikergesetz
12 Berufserkrankungen
13 Berufsgenossenschaft
14 Bedeutende Zahnärzte
15 Literatur
16 Weblinks
17 Einzelnachweise
Geschichte
â Hauptartikel: Geschichte des Zahnarztberufs
Spätgotische Altarfigur der heiligen Apollonia aus Rossau (Sachsen)
Die ersten Zahnärzte praktizierten bereits im 5. Jahrhundert vor Christus. Der erste namentlich bekannte deutsche Zahnarzt war im 15. Jahrhundert ein gewisser Ottinger, von dem in einer Handschrift verschiedene zahnmedizinische Behandlungsanweisungen überliefert sind.[3] Das Fachbuch Le chirurgien dentiste des Franzosen Pierre Fauchard begründete im Jahr 1728 die moderne Zahnheilkunde. Früher behandelten und zogen Barbiere Zähne. Sie hatten geeignete Instrumente wie Hebel, Nadeln, Scheren und Klingen und konnten sie im stets verfügbaren warmen Seifenwasser säubern.
Das Dentalhistorische Museum in Zschadraàbei Colditz (Sachsen) gibt einen ÃÂberblick über die Geschichte der Zahnmedizin.
Apollonia ist die Schutzpatronin der Zahnärzte.
Historische Entwicklung des Berufsbilds in Deutschland
ab 1825
Das preuÃÂische Medizinalreglement legt erste Anforderungen an den Zahnarztberuf fest
ab 1869
Der Norddeutsche Bund legt die erste Prüfungsordnung fest und schützte damit den Begriff âÂÂZahnarztâÂÂ; Pflicht: 2 Jahre Studium und praktische Erfahrungen beim Zahnarzt
ab 1889
Einheitliche Prüfungsordnung
ab 1910
Errichtung dentistischer Lehrinstitute. Dentisten werden 2 Jahre geschult, es folgen 4 Jahre Praktikum
ab 1919
Möglichkeit der Promotion für Zahnmediziner, Titel: âÂÂDr. med. dent.âÂÂ
ab 1920
Dentistenausbildung wird anerkannt, die Berufsbezeichnung âÂÂZahnhandwerkerâÂÂ/âÂÂZahnkünstlerâ abgeschafft
ab 1952
Das Zahnheilkundegesetz schafft den Dualismus Dentist/Zahnarzt ab. Dentisten erhalten übergangsweise nach einer Zusatzausbildung ebenfalls die Berufsbezeichnung âÂÂZahnarztâÂÂ
ab 1965
Erste Zulassungsbeschränkung für den Studiengang Zahnmedizin
Ausbildung
â Hauptartikel: Studium der Zahnmedizin
Die zahnärztliche Ausbildung umfasst
ein Studium der Zahnheilkunde von zehn Semestern an einer wissenschaftlichen Hochschule, das sich aus einem vorklinischen und einem klinischen Teil von je fünf Semestern zusammensetzt;
folgende staatliche Prüfungen:
a) die naturwissenschaftliche Vorprüfung,
b) die zahnärztliche Vorprüfung und
c) die zahnärztliche Prüfung.
Die Regelstudienzeit im Sinne des ç 10 Abs. 2 des Hochschulrahmengesetzes beträgt einschlieÃÂlich der Prüfungszeit für die zahnärztliche Prüfung nach ç 33 Abs. 1 Satz 1 zehn Semester und sechs
Monate. Das Studienfach der Zahnmedizin unterliegt einer Zulassungsbeschränkung (Numerus clausus).
Nach dem Staatsexamen erhält der Zahnmediziner auf Antrag die Approbation als Zahnarzt. Die Einzelheiten des Approbationsverfahrens ergeben sich aus der Approbationsordnung für Zahnärzte.
Etwa die Hälfte der Absolventen promoviert anschlieÃÂend zum Dr. med. dent. Dieser akademische Titel war noch Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland nicht eingeführt. Die Zeitschrift Die Woche meldete in ihrer Ausgabe 51 vom 20. Dezember 1913 deswegen einen Studentenstreik: âÂÂIn Berlin stellten die Studenten der Zahnheilkunde den Besuch der Vorlesungen ein, weil das Kultusministerium die Einführung des Titels Dr. med. dent. ablehnt.âÂÂ
Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vereinheitlichte die Definition des Berufes Zahnarzt; jedoch dauerte es einige Jahre, die nationalen Approbationsordnungen europaweit dem Urteil anzupassen.
Approbation
Mit der Approbation wird die Erlaubnis zur Berufsausübung erteilt. Mit Beginn der Berufsausübung wird der Zahnarzt Zwangsmitglied der für ihn zuständigen Zahnärztekammer, deren Berufsaufsicht er bis zu seinem Ableben untersteht.[4] Die zuständige Zahnärztekammer ist diejenige, in deren Zuständigkeitsbereich er seine Praxis oder â ohne eigene Praxis â seinen Hauptwohnsitz hat.
Die Approbationsordnung für Zahnärzte und Zahnärztinnen wurde am 8. Juli 2019 neu gefasst (BGBl. I S. 933). Die Neufassung tritt am 1. Oktober 2020 in Kraft.
Weiterbildung
Fachzahnarzt für Kieferorthopädie
Der Fachzahnarzt für Kieferorthopädie ist ein Zahnarzt, der nach seinem Studium eine vierjährige Weiterbildungszeit absolviert hat, wovon mindestens ein Jahr an einer Klinik stattfinden muss. Er befasst sich mit der Erkennung, Verhütung und Behandlung von Zahn- und Kieferfehlstellungen sowie mit der Orthopädie des Kiefergelenks. âÂÂKlammernâ und âÂÂZahnspangenâ regulieren und optimieren Kiefer- und Zahnstellung. Nach erfolgreicher Prüfung vor der zuständigen Zahnärztekammer wird ihm die Facharztbezeichnung âÂÂFachzahnarzt für Kieferorthopädieâ verliehen.
Fachzahnarzt für Oralchirurgie
Ein Fachzahnarzt für Oralchirurgie ist ein Zahnarzt mit Gebietsbezeichnung, der nach seiner Approbation eine mindestens vierjährige Weiterbildung absolviert hat. Nach einem obligaten allgemeinen zahnärztlichen Jahr folgen drei fachspezifische Jahre,[5] wovon je nach Bundesland mindestens ein Jahr an einer Klinik stattfinden muss. In einigen Bundesländern (z. B. Hessen) kann das Klinikjahr inzwischen durch curriculare Theoriemodule ersetzt werden[6]. Während der Weiterbildung bei einer durch die zuständige Zahnärztekammer ermächtigten Weiterbildungsstätte (Praxis und/oder Klinik) werden umfassende Fertigkeiten und Qualifikationen in Bezug auf oralchirurgische Eingriffe im Zahn-, Mund- und Kieferbereich und in der Implantologie erworben. Das von einem Fachzahnarzt für Oralchirurgie abgedeckte Spektrum â in Bezug auf die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde â ist dabei dem ambulanten Spektrum des Facharztes für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie, der die Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde aufgrund seiner zusätzlichen zahnärztlichen Approbation ausüben darf, sehr ähnlich und führt zu zahlreichen ÃÂberschneidungen. Das Spektrum des Fachzahnarztes für Oralchirurgie umfasst dabei die gesamte operative Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde im gesamtmedizinischen Kontext.[6] Nach der absolvierten Weiterbildung mit Nachweis eines je nach Bundesland unterschiedlich definierten Operations- und Weiterbildungskatalogs sowie bestandener Prüfung vor der zuständigen Zahnärztekammer darf er die Bezeichnung âÂÂFachzahnarzt für Oralchirurgieâ oder âÂÂZahnarzt, Oralchirurgieâ führen. Umgangssprachlich wird der Fachzahnarzt für Oralchirurgie häufig auch abgekürzt âÂÂOralchirurgâ genannt.
Mund- Kiefer- Gesichtschirurg
Der Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie hat sowohl ein Studium der Humanmedizin als auch ein Studium der Zahnmedizin absolviert, wobei ein erheblicher Teil des Medizinstudiums auf das Zahnmedizinstudium angerechnet wird, da es sich bei beiden Studiengängen um sehr eng verwandte Studiengänge handelt. Er ist doppelapprobiert. Schon während des Studiums der Zahnmedizin kann die mindestens 60-monatige Weiterbildung zum Facharzt absolviert werden, die durch die Facharztprüfung abgeschlossen wird. Diese erfolgt vor der jeweiligen ÃÂrztekammer, von der die Bezeichnung âÂÂFacharzt für Mund-, Kiefer- Gesichtschirurgieâ verliehen wird. Es besteht die Möglichkeit, nach Vorlage der nötigen Operationskenntnisse, der zusätzlichen Fachzahnarztprüfung vor der Zahnärztekammer, die bei Bestehen zusätzlich die Bezeichnung âÂÂFachzahnarzt für Oralchirurgieâ verleiht. Der Facharzt für Mund-, Kiefer- und Gesichtschirurgie ist in vielen Ländern nicht anerkannt (z. B. in Skandinavien). In den Ländern Nordamerikas (USA und Kanada), Japan, Australien und Neuseeland ist die âÂÂmaxillo-facial surgeryâ ein zahnärztliches Fachgebiet (dental speciality).
ÃÂffentliches Gesundheitswesen
Eine eher selten absolvierte Fachzahnarztausbildung ist diejenige zum Fachzahnarzt für ÃÂffentliches Gesundheitswesen. Die Weiterbildung zum Fachzahnarzt für ÃÂffentliches Gesundheitswesen vermittelt die Befähigung, den Gesundheitszustand der Bevölkerung und bestimmter Bevölkerungsteile auf dem Gebiet der Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten zu ermitteln und zu überwachen.
Master
Mittlerweile gibt es einige Zusatzqualifikationen für Zahnärzte, die aufgrund eines Postgraduiertenstudiums erworben werden können. Dazu zählt vor allem der Master-Titel einer Hochschule oder Universität. Als erster Master wurde 2004 der Titel Master of Oral Medicine in Implantology von der Universität Münster an 15 Zahnärzte verliehen. Zusammen mit anderen Implantologie-Mastern haben diese sich im Masterverband Implantologie zusammengeschlossen. Die Master-Ausbildung war längere Zeit im Umbruch; mittlerweile hat sich der einheitliche Titel Master of Science etabliert.[7]
Der akademische Grad Master of Science wird nach den Bologna-Kriterien auch für zahnmedizinische Fächer nach einem Postgraduiertenstudium vergeben.
Fortbildung
Die generelle Fortbildungsverpflichtung des Zahnarztes ist in der Musterberufsordnung[8] der Bundeszahnärztekammer und in den Berufsordnungen der Landeszahnärztekammern vorgeschrieben.
Der Zahnarzt kann durch Fortbildung verschiedene Tätigkeitsschwerpunkte wie âÂÂImplantologieâ oder âÂÂParodontologieâ führen, deren Voraussetzungen je nach Bundesland (das legen die Zahnärztekammern fest) variieren können.
Seit dem 1. Juli 2004 besteht die Pflicht zur fachlichen Fortbildung für alle Vertragszahnärzte, ermächtigten Zahnärzte und in Zahnarztpraxen oder Medizinischen Versorgungszentren (MVZ) angestellte Zahnärzte, die mit Sanktionen belegt ist, gemäàç 95d SGB V:
Der Vertragsarzt ist verpflichtet, sich in dem Umfang fachlich fortzubilden, wie es zur Erhaltung und Fortentwicklung der zu seiner Berufsausübung in der vertragsärztlichen Versorgung erforderlichen Fachkenntnisse notwendig ist. Die Fortbildungsinhalte müssen dem aktuellen Stand der wissenschaftlichen Erkenntnisse auf dem Gebiet der Medizin, Zahnmedizin oder Psychotherapie entsprechen. Sie müssen frei von wirtschaftlichen Interessen sein.
Der Nachweis über die Fortbildung kann durch Fortbildungszertifikate der Kammern der ÃÂrzte, der Zahnärzte sowie der Psychologischen Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten erbracht werden. Andere Fortbildungszertifikate müssen den Kriterien entsprechen, die die jeweilige Arbeitsgemeinschaft der Kammern dieser Berufe auf Bundesebene aufgestellt hat. In Ausnahmefällen kann die ÃÂbereinstimmung der Fortbildung mit den Anforderungen nach Absatz 1 Satz 2 und 3 auch durch sonstige Nachweise erbracht werden; die Einzelheiten werden von den Kassenärztlichen Bundesvereinigungen nach Absatz 6 Satz 2 geregelt.
Ein Vertragsarzt hat alle fünf Jahre gegenüber der Kassenärztlichen Vereinigung den Nachweis zu erbringen, dass er in dem zurückliegenden Fünfjahreszeitraum seiner Fortbildungspflicht nach Absatz 1 nachgekommen ist; für die Zeit des Ruhens der Zulassung ist die Frist unterbrochen. Endet die bisherige Zulassung infolge Wegzugs des Vertragsarztes aus dem Bezirk seines Vertragsarztsitzes, läuft die bisherige Frist weiter. Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht oder nicht vollständig, ist die Kassenärztliche Vereinigung verpflichtet, das an ihn zu zahlende Honorar aus der Vergütung vertragsärztlicher Tätigkeit für die ersten vier Quartale, die auf den Fünfjahreszeitraum folgen, um 10 vom Hundert zu kürzen, ab dem darauf folgenden Quartal um 25 vom Hundert. Ein Vertragsarzt kann die für den Fünfjahreszeitraum festgelegte Fortbildung binnen zwei Jahren ganz oder teilweise nachholen; die nachgeholte Fortbildung wird auf den folgenden Fünfjahreszeitraum nicht angerechnet. Die Honorarkürzung endet nach Ablauf des Quartals, in dem der vollständige Fortbildungsnachweis erbracht wird. Erbringt ein Vertragsarzt den Fortbildungsnachweis nicht spätestens zwei Jahre nach Ablauf des Fünfjahreszeitraums, soll die Kassenärztliche Vereinigung unverzüglich gegenüber dem Zulassungsausschuss einen Antrag auf Entziehung der Zulassung stellen. Wird die Zulassungsentziehung abgelehnt, endet die Honorarkürzung nach Ablauf des Quartals, in dem der Vertragsarzt den vollständigen Fortbildungsnachweis des folgenden Fünfjahreszeitraums erbringt.
Niederlassung
Zahnarztpraxis in 360ð, 2019
Als Kugelpanorama anzeigen
Der Zahnarzt kann sich entweder als Vertragszahnarzt oder als Privatzahnarzt in freier Praxis niederlassen oder ist als angestellter Zahnarzt in einer Zahnklinik, in einem Medizinischen Versorgungszentrum oder einer Praxis tätig. Ein weiteres Berufsfeld ist die Forschung.
Zulassung
Nachdem ca. 87 % der Menschen in Deutschland in der Gesetzlichen Krankenversicherung pflichtversichert sind, beantragen fast alle Zahnärzte eine Zulassung als Vertragszahnarzt beim Zulassungsausschuss. Sie werden nach Annahme ihres Antrags auf Kassenzulassung Mitglied der Kassenzahnärztlichen Vereinigung (KZV) ihres Bundeslandes. Sie verpflichten sich damit, sich an die Vorgaben des Sozialgesetzbuchs (SGB V) zu halten. Nach Angaben der KZBV praktizieren rund 53.000 Vertragszahnärzte in Deutschland (Stand 2014).[9] Sie erhalten die Kassenzulassung nach einer mindestens zweijährigen Assistenzzeit (= Vorbereitungszeit) in einer zugelassenen Praxis oder in einer Zahnklinik im Anschluss an das Studium.
Ein Privatzahnarzt hat keine Kassenzulassung und ist daher nicht zur Abrechnung mit den gesetzlichen Krankenkassen berechtigt. Es steht auch den gesetzlich versicherten Patienten frei, einen Privatzahnarzt aufzusuchen. Die Behandlung wird unabhängig vom Versicherungsstatus des Patienten (gesetzlich, privat oder nicht krankenversichert) auf Grundlage der Gebührenordnung für Zahnärzte vom 5. Dezember 2011 direkt mit dem Patienten abgerechnet („Privatrechnung“, Privatliquidation). Nach derzeitiger Rechtslage bekommen gesetzlich versicherte Patienten für die Behandlung bei einem Privatzahnarzt (im Amtsdeutsch: „Nicht-Vertragszahnarzt“) in der Regel keine Kostenerstattung von ihrer Krankenkassen. Dies gilt auch für Not- und Schmerzfälle! Ausnahme: Praktiziert dieser Nicht-Vertragszahnarzt im EU-Ausland, so besteht ein Anspruch des Patienten auf Erstattung der Rechnung durch seine Krankenkasse maximal in Höhe der Kosten, die im Inland angefallen wären.
Der Vertragszahnarzt in der Bundesrepublik Deutschland ist verpflichtet, alle gesetzlich versicherten Patienten nach dem Sachleistungsprinzip zu behandeln. Die Leistungen werden nach Vorlage der elektronischen Gesundheitskarte (eGK) durch den Versicherten über die jeweilige Kassenzahnärztliche Vereinigung mit den Krankenkassen abgerechnet. Gesetzlich versicherte Patienten erhalten im Bereich Zahnersatz eine Eigenanteilsrechnung über diejenigen Kosten, die nicht über die Krankenkassen-Festzuschüsse abgedeckt sind. Im Bereich Kieferorthopädie muss der Patient (bzw. der Zahlungspflichtige) zunächst quartalsweise einen Eigenanteil bezahlen, der nach erfolgreichem Abschluss der Behandlung von der Krankenkasse erstattet wird. Zahnärztliche Behandlungen, die über das Wirtschaftlichkeitsgebot des ç 12 SGB V (medizinisch notwendig, zweckmäÃÂig, wirtschaftlich und ausreichend) hinausgehen, werden auf Grundlage der Gebührenordnung für Zahnärzte vom 5. Dezember 2011 privat berechnet und sind vom gesetzlich versicherten Patienten selbst zu bezahlen. Zahn-Zusatzversicherungen können einen Teil der Kosten erstatten.
Einkommen
Das durchschnittliche Bruttoeinkommen von angestellten Zahnärzten weicht erheblich von dem durchschnittlichen Bruttoeinkommen zahnärztlicher Praxisinhaber ab.
Angestellte Zahnärzte
Das durchschnittliche Einkommen eines angestellten Zahnarztes in Deutschland lag bei 5.245 ⬠Monatsbruttogehalt, einer angestellten Zahnärztin bei 3.609 â¬. (Stand: 2010)[10] Laut umsatzbezogener Kalkulation liegt das Anfangsbruttogehalt eines Assistenzzahnarztes bei etwa 1.500 ⬠monatlich, bei einem angestellten Zahnarzt bei etwa 4.000 â¬.[11] Laut einer Untersuchung der Bundesagentur für Arbeit verdienen Zahnärzte im Angestelltenverhältnis im Median 4323 Euro brutto monatlich (26,27 Euro pro Stunde) â (Stand 2018).[12]
Nach einer Auswertung der APO-Bank aus 2019[13] wird empfohlen, dass nach der Assistenzzeit ein Bruttoeinstiegsgehalt von 4.500 Euro monatlich vereinbart wird, wenn es sich um ein Festgehalt handelt. Nach 10 bis 20 Jahren kann das Festgehalt auf 65.000 bis 85.000 Euro pro Jahr ansteigen. Mit Spezialisierung kann das Festgehalt zwischen 45.000 und 115.000 Euro pro Jahr liegen. In ländlichen Gebieten kann mit einem durchschnittlichen Festgehalt (ohne Umsatzbeteiligung) von 55.000 Euro pro Jahr gerechnet werden, in der GroÃÂstadt mit 60.000 Euro pro Jahr.[14]
Zahnärztliche Praxisinhaber
Bei zahnärztlichen Praxisinhabern in Deutschland liegt der durchschnittliche Reinertrag bei 175.000 Euro jährlich[15] (Stand: 2015) und der Median des Jahresbruttoeinkommens bei 150.500 Euro (Stand: 2016).[16]
Umsatz zu verfügbarem Einkommen je Praxisinhaber 2016 (Median)
Deutschland
Umsatz (Durchschnitt)
495.100,00 â¬
Umsatz je Behandlungsstundea (Durchschnitt)
344,00 â¬
Kosten (Durchschnitt)
âÂÂ334.200,00 â¬
Einnahmen-ÃÂberschuss (Durchschnitt)
160.900,00 â¬
Einnahmen-ÃÂberschuss Medianb
144.000,00 â¬
Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag, soziale Sicherung
âÂÂ57.400,00 â¬
Verfügbares Einkommen pro Jahrc
86.600,00 â¬
Verfügbares Einkommen pro Monat
7.216,00 â¬
Wochenarbeitszeitd
45,8 Stunden
Nettohonorar pro Stunde
35,86 â¬
a Bei 35 Behandlungsstunden pro Woche und 46 Arbeitswochen.
b Median: 50 % der Zahnärzte verdienen mehr, 50 % der Zahnärzte verdienen weniger als den Medianwert.[17]
c Aus dem verfügbaren Einkommen sind Rücklagen zu bilden, um steigende Preise bei Reinvestitionen auffangen zu können. Das verfügbare Einkommen muss darüber hinaus dafür dienen, Investitionen in Innovationen zu tätigen (beispielsweise Lasertechnologie, digitale Röntgengeräte), Thermodesinfektor.
d einschlieÃÂlich Verwaltung und Fortbildung
Der Anteil der Ausgaben für zahnärztliche Behandlungen an den Gesamtausgaben im deutschen Gesundheitswesen (2014: 193,6 Mrd. â¬) sank von 15,1 % im Jahre 1976 auf 6,7 % (2014: 13,0 Mrd. â¬) im Jahr 2014.
Laut der kassenzahnärztlichen Bundesvereinigung lag das durchschnittliche Bruttoeinkommen von zahnärztlichen Praxisinhabern in Deutschland im Jahr 2018 bei 168.700 Euro. (Stand: 2018)[18]
Die Durchschnittswerte nach Praxisstandort können aus der folgenden Tabelle (auf Tsd. EUR gerundet) abgelesen werden:
Praxisstandort
Durchschnittliches Bruttoeinkommen je Praxisinhaber 2018 (auf Tsd. EUR gerundet)
Zahnarztpraxen (Bundesgebiet)
169.000 EUR
Zahnarztpraxen (Westdeutschland)
176.000 EUR
Zahnarztpraxen (Ostdeutschland)
139.000 EUR
Es existieren jedoch groÃÂe Unterschiede zwischen den Einkommen der zahnärztlichen Praxisinhaber.[19] So hatten 28,7 % aller Praxisinhaber im Jahr 2018 ein Bruttoeinkommen von unter 100.000 Euro und 17,7 % der Praxisinhaber hingegen ein Bruttoeinkommen von über 250.000 Euro. Deutlich zeigten sich die Einkommensunterschiede auch in Bezug auf den Praxisstandort. Während 36,9 % der ostdeutschen Praxisinhaber im Jahr 2016 ein Bruttoeinkommen von unter 100.000 Euro hatten, lag dieser Wert bei westdeutschen Praxisinhabern nur bei 26,9 %. Hingegen hatten 19,7 % aller westdeutschen Praxisinhaber ein Bruttoeinkommen von über 250.000 Euro, während dies nur auf 9,9 % aller ostdeutschen Praxisinhaber zutraf.
Zudem sind die Einkommensverhältnisse von zahnärztlichen Praxisinhabern seit Jahren gröÃÂeren Veränderungen unterworfen. Seit Mitte der 1970er Jahre nahm das durchschnittliche Einkommen der Praxisinhaber inflationsbereinigt bis zur Jahrtausendwende um etwa 50 % ab. Erst seit 2006 ist wieder eine anhaltend positive Entwicklung auszumachen.
Die historischen durchschnittlichen Einkommenswerte der westdeutschen Praxisinhaber sowie die diesen im Jahr 2020 (inflationsbereinigt) entsprechenden Einkommenswerte können aus der folgenden Tabelle (auf Tsd. EUR gerundet) abgelesen werden:
Jahreszahl
Bruttoeinkommen (nominal)[20] in EUR
Entspricht 2020
1976
103.000 EUR (201.000 DM)
258.000 EUR
1980
114.000 EUR (223.000 DM)
247.000 EUR
1985
107.000 EUR (210.000 DM)
192.000 EUR
1990
94.000 EUR (184.000 DM)
158.000 EUR
1995
98.000 EUR (192.000 DM)
138.000 EUR
2000
100.000 EUR (195.000 DM)
133.000 EUR
2005
110.000 EUR
135.000 EUR
2010
131.000 EUR
149.000 EUR
2015
163.000 EUR
173.000 EUR
Nach einer Studie[21] des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) aus dem Jahre 2012 beträgt der durchschnittliche Nettolohn pro Stunde nach Studienabschlüssen/Ausbildungen 12 ⬠für Männer und 9 ⬠für Frauen. Die DIW-Untersuchung stützt sich auf Daten des Mikrozensus der Jahre 2005 bis 2008. Der durchschnittliche âÂÂNettolohnâ von Zahnärzten beträgt gemäàdieser Studie 19,33 ⬠und von Zahnärztinnen 15,50 â¬. (Die Berechnung eines durchschnittlichen Stundenlohns erfolgte über die maximal mögliche Erwerbsphase. Hierzu wurden die Stundenlöhne in jedem Alter, Beruf und Ausbildungsgang aufsummiert und mit der maximal möglichen Erwerbsdauer [44 Jahre] in Relation gesetzt.)
Berufsrecht
Zahnarzt ist ein klassischer Kammerberuf.
Deutsche Zahnärzte unterliegen verschiedenen berufsrechtlichen Regelungen: dem Zahnheilkundegesetz, der Approbationsordnung und der Berufsordnung der zuständigen Zahnärztekammer. Die Honorarberechnung erfolgt nach der Gebührenordnung für Zahnärzte (GOZ) und dem BewertungsmaÃÂstab zahnärztlicher Leistungen (BEMA).
Daneben gelten Sonderbestimmungen, etwa für eine Zahnarztwebsite: seit dem 1. März 2007 unterliegen derartige Internetpräsenzen wie alle Websites den Vorgaben des ç 5 Telemediengesetz (TMG). Einschränkende Vorgaben für die Gestaltung einer Praxiswebsite sind in den Berufsordnungen der Zahnärztekammern nur rudimentär vorhanden.
â Hauptartikel: Arztwerberecht
Heilpraktikergesetz
Faltenunterspritzungen im Stirn-, Augen- und Halsbereich, zur Lippen- und Faltenunterfüllung und zur Therapie der Migräneerkrankung sind approbierten ÃÂrzten und Heilpraktikern erlaubt, dem Zahnarzt und anderen Heilberufsangehörigen sowie Laien hingegen untersagt. (ç 5 Heilpraktikergesetz). Das Oberverwaltungsgericht für das Land Nordrhein-Westfalen bejahte die für den Approbationsentzug vorausgesetzte Unzuverlässigkeit eines Zahnarztes angesichts dessen jahrelanger VerstöÃÂe gegen das Verbot der Faltenunterspritzungen. Man hielt dem Zahnarzt sein langjähriges und hartnäckiges Verhalten vor, was er nur durch einen ernsthaften Einstellungswandel hätte beseitigen können.[22]
Berufserkrankungen
Zahnärzte erleiden häufig erworbene Krankheiten der Wirbelsäule wie Bandscheibenvorfälle. Alle Bereiche der Wirbelsäule sind gefährdet, eine Häufung besteht im Bereich der Halswirbelsäule.
Zahnärzte erkranken, so wie auch Zahntechniker, häufig an allergischen Reaktionen der Haut sowie an toxischen Kontaktdermatitiden insbesondere der Hände. Ursache hierfür ist der häufige direkte oder indirekte Kontakt mit toxischen (schädigenden) Substanzen und Materialien wie z. B. unausgehärteten Kunststoffen (Methylmethacrylat), Quecksilber, Palladium sowie Lösungsmitteln. Vor einer Hepatitis B schützen Impfungen.
Berufsgenossenschaft
Eine Zahnarztpraxis gehört zu den beitragspflichtigen Unternehmen in der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Versichert sind alle Arbeitnehmer sowie pflichtversicherte Unternehmer. Unternehmer, die nicht der Versicherungspflicht unterliegen, können sich freiwillig versichern. Ehrenamtlich beziehungsweise unentgeltlich Tätige sind ebenfalls versichert. Die BGW trägt im Versicherungsfall die Kosten für eine Vielzahl von Leistungen. Staatliche Einrichtungen im Gesundheitsdienst werden nicht von der BGW betreut. Zuständig sind hier die Versicherungsträger der öffentlichen Hand (Unfallkassen). Selbstständig tätige Zahnmediziner können sich freiwillig bei der BGW umfassend gegen Folgen von Arbeits- und Wegeunfällen sowie von Berufskrankheiten versichern. Die BGW trägt die Kosten für eine individuell abgestimmte medizinische, berufliche und soziale Rehabilitation, zahlt das Verletztengeld als Ersatz für Verdienstausfall während der medizinischen Rehabilitation, sichert im Fall einer Minderung der Erwerbsfähigkeit mit einer Rente ab und sorgt im Todesfall für die Hinterbliebenen: Je nach Sachlage zahlt sie Renten, Sterbegeld, ÃÂberführungskosten oder Beihilfen.[23]
Bedeutende Zahnärzte
Edward H. Angle
Sanford Christie Barnum
Greene V. Black
Pierre Fauchard
Alfred Gysi
Willoughby D. Miller
Carl Partsch
Philipp Pfaff
Horst Sebastian
Maria Schug-Kösters
Otto Walkhoff
Siehe auch: Kategorie Zahnarzt
Literatur
Peter Guttkuhn: Von Zähnen, Warzen und Leichdörnern. Aus der Praxis des Lübecker Zahnarztes Jacob Levy (1784âÂÂ1840). In: Schleswig-Holsteinisches ÃÂrzteblatt. 47 (1994), Heft 1, S. 7âÂÂ9.
Dominik GroÃÂ: Die schwierige Professionalisierung der deutschen Zahnärzteschaft (1867âÂÂ1919). In: Europäische Hochschulschriften, Reihe 3, 609, Frankfurt a. M. 1994.
Dominik GroÃÂ: Zahnarzt und Zahnbrecher. In: Enzyklopädie Medizingeschichte. Hrsg. von Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil und Wolfgang Wegner, Walter de Gruyter, Berlin und New York 2005, S. 1515 f.
Gereon Schäfer, Dominik GroÃÂ: Zwischen Beruf und Profession: Die späte Professionalisierung der deutschen Zahnärzteschaft und ihre Hintergründe. In: Deutsche Zahnärztliche Zeitschrift, 62/11, 2007, S. 725âÂÂ732.1
Weblinks
Wiktionary: Zahnarzt â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Wikiquote: Zahnarzt â Zitate
Commons: Zahnärzte bei der Arbeit â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung
Deutsche Gesellschaft für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde
Bohrlöcher aus der Steinzeit. Auf: wissenschaft.de vom 6. April 2006 über einen Artikel in Nature (Bd. 440, 2006, S. 755)
Einzelnachweise
â Bundeszahnärztekammer Mitgliederstatistik
â Bezug auf IAB Forschungsgruppe Berufliche Arbeitsmärkte ulmato.de
â Wolfgang Wegner: Ottingen (Ottinger). In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 1085.
â Bayerisches Heilberufekammergesetz
â Musterweiterbildungsordnung. (PDF) Bundeszahnärztekammer, abgerufen am 6. Dezember 2016.
â a b Pilotprojekt Oralchirurgie. (Nicht mehr online verfügbar.) Hessische Landeszahnärztekammer, archiviert vom Original am 6. Dezember 2016; abgerufen am 6. Dezember 2016.
â moi.uni-frankfurt.de. Abgerufen am 15. Dezember 2014.
â Musterberufsordnung, Stand 19. Mai 2010. (PDF; 45 kB) Bundeszahnärztekammer
â Daten und Fakten 2015. (PDF) Faltblatt mit statistischen Angaben zur vertragszahnärztlichen Versorgung von KZBV und BZÃÂK
â Statistisches Bundesamt, Verdienststrukturerhebung 2010
â D. Nies, K. Nies: Wieviel âÂÂdarfâ ein angestellter Zahnarzt oder Assistent verdienen? (PDF) Abgerufen am 15. Dezember 2014
â Angestellte Zahnärzte verdienen 4.323 Euro brutto, zm-online, 8. April 2019. Abgerufen am 9. April 2019.
â Gehalt Zahnarzt, APO-Bank
â Zu diesen Konditionen arbeiten angestellte Zahnärzte 2019, Zahnärztliche Mitteilungen, 8. Juli 2019. Abgerufen am 9. Juli 2019.
â Kostenstruktur bei Arztpraxen (PDF)
â Statistisches Jahrbuch 2018 (PDF) KZBV. Abgerufen am 12. Mai 2019.
â Statistisches Jahrbuch 2015. Kassenzahnärztliche Bundesvereinigung (KZBV), ISBN 978-3-944629-03-2
â KZBV Jahrbuch 2020. Abgerufen am 2. März 2021.
â KZBV Jahrbuch 2020. Abgerufen am 2. März 2021.
â KZBV Jahrbuch 2020. Abgerufen am 2. März 2021.
â Daniela Glocker, Johanna Storck: Uni, Fachhochschule oder Ausbildung, welche Fächer bringen die höchsten Löhne? (PDF; 489 kB) DIW, Wochenbericht 13/2012
â Beschluss vom 17. Mai 2017 â Az.: 13 A 168/16, Oberverwaltungsgericht Nordrhein-Westfalen
â Freiwillige Versicherung für Zahnärztinnen und Zahnärzte. (PDF; 561 kB) Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege, abgerufen am 26. März 2018.
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4067303-0 (OGND, AKS)
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Zahnarzt&oldid=209401703âÂÂ
Kategorien: ZahnarztFreier Beruf (Deutschland)HeilberufBerufsbild in der ZahnmedizinHochschulberufVersteckte Kategorie: Wikipedia:Deutschlandlastig
Navigationsmenü
Meine Werkzeuge
N
Firmengründung GmbH Bürgschaften
Top 4 verkaufsbedingungen:

Zur Suche springen
Turmkräne der Hersteller Liebherr (gelb) und Wolffkran (rot, Toplesskrane) bei der Errichtung der Seestadt Aspern
Montage eines Obendrehers des Herstellers Wolffkran
Obendrehender Turmkran Liebherr-710 HC-L 32/64 Litronic
Ein Turmkran ist eine Hebemaschine (Kran) zum vertikalen Heben von Lasten, die meist mittels einer Laufkatze auch horizontal verfahren werden können. Ein Turmdrehkran, kurz TDK, kann seinen Ausleger zusätzlich mithilfe eines Drehkranzes seitlich verschwenken und die Last somit in allen drei Dimensionen verfahren. Tragwerk und Ausleger des Krans werden häufig als Fachwerkträger ausgeführt.
Turmdrehkräne werden insbesondere auf Baustellen im Hoch- und Tiefbau eingesetzt. Unterschieden werden unten- und obendrehende Turmdrehkräne mit Katz- und mit Nadelausleger.
Inhaltsverzeichnis
1 Geschichte
2 Untendrehender Turmkran
3 Obendrehender Turmkran
4 Katzausleger
5 Nadelausleger
6 Wipp- und Toplesskrane
7 Siehe auch
8 Literatur
9 Weblinks
10 Einzelnachweise
Geschichte
Erste Turmkrankonstruktionen wurden um 1910 entwickelt. Zu den Herstellern der ersten Stunde zählen Unternehmen wie Heinrich Rieche aus Kassel und Carl Peschke (Pekazett) aus Zweibrücken (heute KSD Kransysteme GmbH). Es folgten das Unternehmen Kaiser & Schlaudecker (später Otto Kaiser KG Maschinenfabrik) aus St. Ingbert im Jahr 1912 mit einer wegweisenden und früher weit verbreiteten Entwicklung im Bereich der Hochbaukrane und ab 1913 auch das Heilbronner Unternehmen Julius Wolff (später Wolffkran) mit seinem ersten obendrehenden Baukran in âÂÂGlockenauslegerbauweiseâÂÂ. Alle Krankonstruktionen der vorgenannten Hersteller hatten noch ein sogenanntes Kranportal als gleisgebundenen Unterbau.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kamen selbstaufstellende und schnell umsetzbare Turmkräne auf den Markt. So entwickelte beispielsweise der Kirchdorfer Baumeister Hans Liebherr, Gründer des gleichnamigen Baumaschinenherstellers, im Jahr 1949 einen schnell zu transportierenden und montierenden Turmdrehkran. Auch andere Hersteller widmeten sich in dieser Zeit der Fertigung von Turmkranen und versuchten die ständig steigende Nachfrage zu decken. Durch das Aufkommen des Kletterkrans in den 1960er Jahren wurden die Einsatzmöglichkeiten von Turmkränen noch erweitert. Später kamen die Funkfernsteuerung und elektronisch programmierbare Kransteuersysteme hinzu.
Untendrehender Turmkran
Untendrehende Turmdrehkrane (Untendreher) bestehen aus einem Unterwagen mit Drehkranz, auf dem der Kranturm drehbar befestigt ist. Der Ausleger ist fest mit dem Kranturm verbunden und meist über Turmspitze und sehr kurzen Gegenausleger bis zum Gegengewicht über Zugseile abgespannt. Das erforderliche Gegengewicht (Ballast) ist seitlich an der Basis des Kranturms angesetzt und dreht sich mit diesem. Eine seitliche Bewegung des Auslegers ist nur über eine Drehung des gesamten Kranturms möglich. Das Gegengewicht dreht sich in der Regel innerhalb der Aufstellfläche der Abstützungen des Unterwagens. Ein Kran, der unmittelbar mit einer Bodenplatte verschraubt oder in dieser einbetoniert ist, benötigt keine besondere Aufstellfläche. In diesem Fall muss für das ausschwenkende Gegengewicht des untendrehenden Krans eine im Vergleich zu Obendrehern gröÃÂere Fläche freigehalten werden.
Der weltgröÃÂte Turmdrehkran Kroll K-10000 ist ein Untendreher mit einem hohen Lastmoment von 10.000 Meter mal Tonne, das heiÃÂt, er kann eine Traglast von 120 Tonnen am Ausleger in einer Entfernung von 82 Metern zum Kranturm anheben. Sein Ballastgewicht befindet sich wie bei einem Obendreher am Ende des Gegenauslegers.[1]
Die Anschaffungs- und Vorhaltekosten untendrehender Turmkrane sind geringer als bei Obendrehern. Auch Auf- und Abbau gestalten sich einfacher. Sie werden häufig auch als Schnellmontagekrane angeboten. Diese werden vormontiert auf die Baustelle gebracht, auf tragfähigen Boden gesetzt und innerhalb weniger Minuten automatisch aufgerichtet. Untendreher werden vor allem auf kleinen und mittleren Baustellen eingesetzt.
Bei gröÃÂeren Turmhöhen und Lastmomenten ergeben sich beim Untendrehersystem Nachteile, da der steigende Platzbedarf durch längere Ausleger am Boden schnell zu Problemen führt, während die Ausleger beim Obendrehsystem am oberen Ende des Krans in der Regel wenig stören. Falls untendrehende Turmdrehkrane auf Fahrzeuge montiert werden, werden diese als Mobilbaukrane bezeichnet.
Obendrehender Turmkran
Obendrehender Turmkran
Der Kranturm obendrehender Turmdrehkrane (Obendreher) ist fest auf dem Turm- oder Fundamentkreuz montiert, auf dem auch der Zentralballast liegt. Alternativ kann der Turm mit einer Fundamentplatte verbunden werden, etwa über einbetonierte Fundamentanker.
Bis zu einer hersteller- und typabhängigen Turmhöhe können diese Krane auch schienenfahrbar auf entsprechenden Unterwagen montiert werden.
Das Drehwerk befindet sich am oberen Ende des Kranturms. Bei Drehbewegungen werden nur der Ausleger und der ihm gegenüberliegende Gegenausleger bewegt, die an der Kranspitze abgespannt werden können. Der Gegenausleger wird mit Ballast beschwert, so dass bei halber Belastung des Auslegers im Drehwerk kein Moment auftritt.
Insbesondere bei gröÃÂeren Turmhöhen und Lasten wirkt sich vorteilhaft aus, dass der Drehkranz von obendrehenden Kranen geringer belastet wird, da
das Gewicht des Kranturms nicht auf ihm lastet und
das durch Traglast und Wind bewirkte Drehmoment sich aufgrund des kürzeren Hebelarms reduziert.
Weitere Vorteile des Obendrehers sind der geringe Platzbedarf im Bereich des Aufstellortes sowie die groÃÂen Turmhöhen, die erreicht werden, wenn der Turm am Bauwerk verankert wird. Aufgrund des geringen Platzbedarfs können Obendreher auch mitten im Gebäude verankert werden, z. B. in einem künftigen Treppenhaus oder Aufzugschacht.
Obendreher werden auch als Kletterkrane ausgeführt, die durch Klettervorrichtungen in der Lage sind, ihren Turm durch Einbau neuer TurmstöÃÂe ohne Mithilfe anderer Hebemittel zu verlängern oder zu verkürzen.
Katzausleger
Ausleger mit Laufkatze
Die meisten im mitteleuropäischen Raum eingesetzten Turmdrehkrane sind Krane mit Laufkatzausleger. Ein Laufkatzausleger ist waagerecht am Kranturm angebracht und kann meist in der Höhe nicht verändert werden (bis auf manche Untendreher, die auch mit steilerer Auslegerneigung aufgebaut werden können). Der Lastentransport erfolgt mit Hilfe einer Laufkatze, die sich entlang des Auslegers bewegen kann und das Hubseil mit sich führt.
Eine Sonderform des Laufkatzauslegers ist der sogenannte Biegebalkenausleger, der bei spitzenlosen, sogenannten Topless-Kranen verbaut wird. Der biegesteif mit dem Gegenausleger verbundene Ausleger benötigt keine Abspannung über eine Turmspitze, so dass er insgesamt weniger Höhe einnimmt. Bei diesem Krantyp ist die Lastgrenze allerdings eher erreicht als bei Kranen mit Turmspitze.
Die Biegebalkenauslegerkonstruktion ist eine der ältesten Auslegerbauarten. Bereits im Jahr 1912 wurde eine der ersten Krankonstruktionen mit einem Biegebalkenausleger ausgeführt. Hans Liebherr, Gründer des gleichnamigen Baumaschinenkonzerns, griff im Jahre 1949 diese Auslegerbauform ebenfalls für seine ersten Kranentwicklungen auf.
Eine andere Variante ist der Teleskopausleger, bei dem der Ausleger in zwei Teile unterteilt ist, die entweder untereinander oder ineinander geschoben werden können. Das ist vor allem beim Vorbeischwenken an Hindernissen von Vorteil.
Nadelausleger
Turmdrehkran mit Nadelausleger
Nadelausleger werden auch als Verstellausleger bezeichnet. Bei Nadelauslegerkranen ist der Ausleger am Kranturm unterhalb der Turmspitze mit einem Gelenk befestigt und über das Auslegerhubseil, das über die Kranspitze läuft, in der Höhe veränderlich. Krane mit Nadelausleger haben meist keine Laufkatze und die Last wird in Richtung des Auslegers allein über Heben und Senken des Auslegers verfahren.
Die Nadelauslegerkonstruktion bietet bei beengten Platzverhältnissen Vorteile, da der Ausleger beim Heranfahren an Hindernisse wie benachbarte Gebäude hochgezogen werden kann, um eine Kollision zu vermeiden. Dies ist auch dort von Nutzen, wo der Gesetzgeber das ÃÂberfahren benachbarter Grundstücke mit dem Ausleger verbietet, wie in GroÃÂbritannien und in Japan. Durch Aufrichten des Auslegers können weit über die Höhe des Kranturms hinausgehende Hakenhöhen erreicht werden, wodurch gegebenenfalls Turmhöhe eingespart wird.
Das Verfahren der Last in Auslegerrichtung erfordert einen wesentlich stärkeren Antrieb als bei Katzauslegern, da Ausleger und Traglast angehoben werden müssen. Krane mit Nadelausleger kommen vor allem im asiatischen Raum, in GroÃÂbritannien, den USA und Australien sowie in Russland zum Einsatz. In Deutschland sind sie im Hochbau zu finden.
Wipp- und Toplesskrane
Bei den Wipp- oder Toplesskranen (auch Flat-Top-Krane genannt) benötigt der Ausleger keine Abspannung über eine Turmspitze, da er biegesteif mit dem Gegenausleger verbunden ist. Beim Wippausleger kann der gesamte Ausleger ähnlich einem Nadelausleger angehoben werden. Toplesskrane entsprechen Katzauslegerkranen, benötigen jedoch keine Turmspitze, über die der Ausleger abgespannt wird. Dies erlaubt bei groÃÂen Baustellen das leichtere ÃÂberschwenken durch andere Krane. Toplesskrane können schnell montiert werden und setzen sich daher in der Bauindustrie zunehmend durch.
Wolff Ur-Baukran, Museumskran der AG-KBM
Obendrehender Turmdrehkran mit Katzausleger
Obendrehender Toplesskran
Einsatz zweier Kräne mit Nadelausleger beim Bau des One World Trade Center in New York (Aufnahme vom Juli 2010)
Umgefallener Kran
Ein fahrbarer Faltkran (Potain)
Siehe auch
Fahrzeugkran
Feuerwehrkran
Hubarbeitsbühne
Schienendrehkran
Schwimmkran bzw. Kranschiff
Teleskoprohr
Literatur
Johannes Karl Westermann: Turmdrehkrane im Hochbau: Untersuchungen zu automatischen Lastaufnahmeeinrichtungen. Diplomarbeit. Hrsg.: Universität Karlsruhe [TH]. Karlsruhe 2005.
Dirk P. Moeller: Kran- und Baumaschinenmuseum: Von der Idee zur Wirklichkeit. In: Stahlbau. Band 82, Nr. 4. Ernst & Sohn, 3. April 2013, ISSN 0932-6375, S. 302âÂÂ308, doi:10.1002/stab.201320047.
Stephan Bergerhoff, Heinz-Gert Kessel, Pius Meyer: Turmdrehkrane: 100 Jahre auf Baustellen in aller Welt. Podszun, Brilon 2010, ISBN 978-3-86133-560-3.
Stefanie Ehmann, Alexandra Waldenmaier, Erik Bohr (Fotos): Zwischen Himmel und Erde. Hrsg.: Wolffkran. Motorbuch, Stuttgart 2007, ISBN 978-3-613-02724-4.
Martin J. Dougherty: Kräne: Die spektakulärsten Baumaschinen der Welt. Parragon, Bath UK 2008, ISBN 978-1-4075-2396-5.
Karl-Eugen Kurrer: Vom Urbild des Turmdrehkrans. In: VDI nachrichten Nr. 18/2013, 3. Mai 2013, S. 6.
Weblinks
Commons: Turmkräne
AG Kran- und Baumaschinenmuseum e. V.
Kran-Info: Informationen und Bildern zu Turmdrehkranen
Einzelnachweise
â E.B.: Datenblatt des Kroll K-10000 auf www.krollcranes.dk. Abgerufen am 15. April 2016.
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4186479-7 (OGND, AKS)
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Turmkran&oldid=207659821âÂÂ
Kategorien: BaumaschineKran
Navigationsmenü
Meine Werkzeuge
firmenmantel kaufen gmbh kaufen deutschland
gesellschaft kaufen berlin gmbh auto kaufen oder leasen
Top 4 arbeitsvertrag:
Zur Suche springen
Auktionator des Auktionshauses ChristieâÂÂs
Eine Auktion ( Anhören?/i) (auch Versteigerung oder in ÃÂsterreich Lizitation)[1] ist eine Art des Verhandelns über den Verkauf. Bei einer Auktion geben zumeist die Kaufinteressierten (âÂÂBieterâÂÂ) verbindliche Gebote auf ein Auktionsgut ab. Die Auktionsgüter sind oft während der Auktion physisch vorhanden und/oder können vor der Auktion besichtigt werden. Die Bieter machen dem Verkäufer bzw. dem in dessen Auftrag handelnden Auktionator ein Angebot (Willenserklärung, die auf den Abschluss eines Vertrags gerichtet ist). Bei einer traditionellen Auktion obliegt die Abwicklung der Auktion einem Auktionator. Er versteigert die Auktionsgüter an anwesende und/oder telefonisch mitsteigernde Bieter.
Bei den meisten Auktionen steigen die Gebote an â das höchste Gebot wird zuletzt genannt und erhält den Zuschlag. Es gibt jedoch auch sogenannte Rückwärtsauktionen mit absteigenden Geboten.
Hintergrund dieser Preisfindung sind Informationsasymmetrien im Markt. Während der Anbieter seine Ware zu einem höchstmöglichen Preis verkaufen will, möchte der Bieter die Ware zu einem möglichst niedrigen Preis ersteigern. Der Anbieter kennt dabei häufig nicht die Zahlungsbereitschaft der Interessenten. Setzt er einen zu hohen Preis fest, kann er seine Ware nicht verkaufen. Setzt er einen zu niedrigen Preis fest, entgeht ihm ein Teil des möglichen Gewinns. Die Bieter kennen zwar ihre eigene Zahlungsbereitschaft, aber nicht die Zahlungsbereitschaft der anderen Interessenten. Es kommt daher vor, dass ein Bieter sich von anderen Bietern beeinflussen lässt und mehr bietet als ursprünglich geplant. Unter Umständen kann die Konkurrenz der Bieter zu einem sogenannten Bietergefecht führen. Bietergefechte sind nicht möglich, wenn bei einer Rückwärtsauktion der erste Bieter, der ein Gebot abgibt, sofort das Auktionsgut erhält.
Die Auktionstheorie beschäftigt sich mit der Analyse von Auktionsmechanismen und Bieterstrategien aus Sicht der Mikroökonomie und der Spieltheorie.
Inhaltsverzeichnis
1 ÃÂberblick über häufige Auktionsformen
2 Traditionelle Auktion
2.1 Vorbereitung
2.1.1 Einlieferung
2.1.2 Material sichten und prüfen
2.1.3 Material beschreiben
2.1.4 Katalogproduktion
2.1.5 Zirkulare bzw. Katalogbestellungen
2.1.6 Besichtigung des Materials
2.2 Bieter
2.2.1 Saalbieter
2.2.2 Telefonbieter
2.2.3 Internet-Bieter
2.2.4 Schriftliche Gebote
2.3 Auktionsführung
2.3.1 Die Versteigerungsbedingungen
2.3.2 Anwesenheit eines Beamten bei Auktionen in der Schweiz
2.4 Zuschlag
2.4.1 Unter Vorbehalt der Nachprüfung
2.4.2 âÂÂWie es istâÂÂ
2.4.3 Unter Vorbehalt der Zustimmung
2.4.4 Zuschlag von schriftlichen Geboten nach der Auktion
2.5 Nach der Auktion
2.5.1 Rechnungsstellung und Versand der Ware
2.5.2 Reklamationen
2.5.3 Nachverkauf
2.5.4 Einliefererabrechnung
2.5.5 Unverkaufte Lose
3 Online-Auktion
4 Internet-Live-Auktion
5 Auftragsauktion
6 Unterschiedliche Gebotssysteme
6.1 Einseitige und zweiseitige Auktionen
6.2 Offene und verdeckte Auktionen
6.3 Aufsteigende Gebote: englische Auktion und japanische Auktion
6.4 Absteigende Gebote: Rückwärtsauktionen
6.5 Kombinatorische Auktion
6.6 Sonderformen
6.6.1 Amerikanische Versteigerung
6.6.2 Zwei Bieter zahlen
6.6.3 Calcutta-Auktion
7 Rechtliche Grundlagen
8 Tätigkeit als Auktionator
8.1 Vorbildung des Versteigerers
8.2 Fachliche Kenntnisse
8.3 Juristische Kenntnisse
8.4 Auktionatoren in den USA
9 Siehe auch
10 Literatur
11 Weblinks
12 Einzelnachweise
ÃÂberblick über häufige Auktionsformen
Es gibt groÃÂe Unterschiede zwischen Auktionshäusern und zwischen Auktionsmodellen. Traditionelle Auktionshäuser wie SothebyâÂÂs, ChristieâÂÂs, Lempertz oder Dorotheum arbeiten recht ähnlich. Man kann unterscheiden zwischen dem traditionellen Auktionswesen (Versteigerung nach ç 156 BGB) und Online-Auktionen, wie sie z. B. auf eBay stattfinden. Wenn traditionelle Auktionshäuser im Internet Versteigerungen durchführen, so etwa über die deutsche Plattform LOT-TISSIMO, handelt es sich um Internet-Live-Auktionen. Die folgende Tabelle nennt Unterscheidungsmerkmale zwischen traditionellen Auktionen, Online-Auktionen sowie Internet-Live-Auktionen:
Traditionelle Auktion
Online-Auktion
Internet-Live-Auktion
Teilnahme an der Versteigerung im Sinne von ç 156 BGB
Am Ort des Auktionshauses im dortigen Versteigerungssaal, oder per Telefon
Nicht möglich
Mittels Personal Computer, Notebook, Tablet PC und Smartphone oder am Ort des Auktionshauses im dortigen Versteigerungssaal, oder per Telefon
Begutachtung der Ware
Durch Fachleute auf Basis des Originals, eines Zertifikates oder durch Bilder
Durch den Käufer meist auf Basis der Beschreibung und elektronischer Bilder auf der Angebotsseite
Im ersten Schritt über ein Netzwerk von Experten, auf Basis von Fotos und/oder Gutachten. Im zweiten Schritt durch Fachleute auf Basis des Originals, am Ort des Auktionshauses
Beschreibung der Ware
Durch eine vom Auktionator beauftragte unabhängige und qualifizierte Instanz oder durch Experten innerhalb des Auktionshauses
Durch den Verkäufer
Durch eine vom Auktionator beauftragte unabhängige und qualifizierte Instanz oder durch Experten innerhalb des Auktionshauses
Bewertung der Ware
Begründet, objektiv im Vergleich zu Marktstandards
Zum Teil durch den Verkäufer, oft wird keine Bewertung vorgenommen
Begründet, objektiv im Vergleich zu Marktstandards, Veröffentlichung von Auktionsergebnissen online über Datenbanken wie Artnet, manchmal Indexierung von Auktionsergebnisse auf der eigenen Webseite des Auktionshauses
Präsentation der Ware
Oft in aufwändig gestalteten Katalogen
Durch den Verkäufer im Internet
Durch das Auktionshaus mittels High Definition Television Livestream im Internet, vor der Auktion per Onlinekatalog
Besichtigung der Ware
Am Ort der Auktion (zentral) vor und während der Auktion
In der Regel nicht möglich (dezentral beim Verkäufer)
Während der Auktion mittels Livestream im Internet, zusätzlich am Ort der Auktion (zentral) vor und während der Auktion
Dauer der Auktion
Wenige Sekunden bis Minuten für einen Artikel. Wobei viele Auktionshäuser nach der Veröffentlichung der Ware im Auktionskatalog Gebote auch schon im Vorfeld der Auktion schriftlich annehmen. Die Berücksichtigung dieser schriftlichen Gebote erfolgt aber erst beim Aufruf im Auktionssaal.
Wenige Tage bis Wochen für einen Artikel
Wenige Minuten für einen Artikel. Ausnahmslos erst nachdem der Auktionator mittels Aufruf festgestellt hat, dass keiner der Anwesenden, ob an Ort und Stelle oder online, das letzte vorliegende Gebot überbieten möchte.
Gebotabgabe für einen Artikel
Während der Auktion oder schriftlich im Voraus
Innerhalb der Auktionsdauer direkt oder auch mittels eines Biet-Agenten
Während der Auktion online oder am Ort des Auktionshauses, alternativ auch per Telefon, oder im Vorfeld der Auktion online über die Webseite des Auktionshauses, oder über mit dem Auktionshaus syndizierte Partnerwebseiten, sowie per Mail, Fax, Briefpost oder persönlicher ÃÂbergabe am Ort des Auktionshauses als sogenanntes Vorgebot. Die Berücksichtigung von Vorgeboten erfolgt ausnahmslos erst beim Aufruf des Versteigerungsgutes im Auktionssaal.
Ende einer Auktion
Nach Abgabe des höchsten Gebotes
Zu einer festgelegten Zeit
Nach Abgabe des höchsten Gebotes, und dem Ausruf âÂÂZum ersten, zum Zweiten und zum Drittenâ durch den Auktionator, und dem darauf folgenden Hammerschlag
Versand/Export
Durch Auktionshaus organisiert, oder Kunde holt die Ware persönlich ab.
Vom Verkäufer organisiert, oder Kunde holt die Ware persönlich ab.
Durch Auktionshaus organisiert, oder Kunde holt die Ware persönlich ab.
Identität der Käufer und Verkäufer
Sind dem Auktionshaus persönlich bekannt.
Keine sichere ÃÂberprüfung der Identität.
Sind dem Auktionshaus persönlich bekannt. ÃÂberprüfung der Identität von Käufern und Verkäufern erfolgt elektronisch mittels Risikomanagement-Verfahren, meist durch Prüfungsunternehmen wie TÃÂV SÃÂD zertifiziert.
Vorschuss für die Einlieferung
Je nach Art und Wert der Ware wird dem Verkäufer im Regelfall ein verzinslicher Vorschuss gewährt.
Nicht anwendbar
Je nach Art und Wert der Ware wird dem Verkäufer im Regelfall ein verzinslicher Vorschuss gewährt. Der Zinssatz ist auf der Webseite des Auktionshauses einsehbar.
Provisionen/Kommissionen
Wird in der Regel sowohl dem Einlieferer, als auch dem Bieter (Käufer) berechnet. Kann aber auch unterschiedlich abweichen und wird je nach Auktionshaus unterschiedlich gehandhabt.
Wird in der Regel nur dem Verkäufer berechnet.
Käufer und Verkäufer bezahlen unterschiedliche Gebühren, der Tarif ist auf den Webseiten der Auktionshäuser einsehbar.
Zahlungsabwicklungen
Durch Auktionshaus als Treuhänder (anonym)
Meist direkte Abwicklung zwischen Käufer und Verkäufer, sonst im elektronischen Zahlungsverkehr, z. B. per Paypal oder Visa Inc., Mastercard, American Express oder Diners Club
Durch Auktionshaus als Treuhänder, überwiegend im elektronischen Zahlungsverkehr, z. B. per Paypal oder Visa Inc., Mastercard, American Express oder Diners Club
Reklamationen
Durch Auktionshaus vermittelt, überprüft und geschlichtet (anonym). Wenn Auktionshäuser im Auftrag arbeiten, ist eine direkte Bekanntgabe des Einlieferers auf Verlangen jederzeit möglich, aber in der Regel nicht üblich.
Meist direkte Abwicklung zwischen Käufer und Verkäufer
Durch Auktionshaus vermittelt, überprüft und geschlichtet (anonym). Zertifizierung des Schlichtungsprozesses durch Prüfungsunternehmen wie TÃÂV SÃÂD oder Trusted Shops.
Als wichtigste Aufgaben eines traditionellen Auktionshauses gelten die fachlich fundierte und angemessene Beschreibung und Dokumentation der Ware sowie die treuhänderische Abwicklung des Handelsgeschäftes.
Traditionelle Auktion
Dieser Artikel oder nachfolgende Abschnitt ist nicht hinreichend mit Belegen (beispielsweise Einzelnachweisen) ausgestattet. Angaben ohne ausreichenden Beleg könnten demnächst entfernt werden. Bitte hilf Wikipedia, indem du die Angaben recherchierst und gute Belege einfügst.
Vorbereitung
Einlieferung
Den gesamten Posten aller einzelnen Teile, die zu einer Auktion versteigert werden soll, nennt man Einlieferung und denjenigen, der die Ware dem Auktionshaus zur Versteigerung überlässt, nennt man entsprechend Einlieferer.
In der Regel wird zwischen dem Verkäufer (Einlieferer) und dem Auktionshaus eine Vereinbarung getroffen, einen wertvollen Gegenstand, eine Sammlung oder einen Teil davon zu verkaufen. Das Zustandekommen einer solchen Vereinbarung kann sehr verschieden erfolgen:
Es handelt sich um einen Nachlass, und die Erben versuchen zu verkaufen.
Ein Sammler will sich von einem Teil seiner Sammlung lösen.
Ein Händler versucht, einen besonderen Posten optimal zu verkaufen.
Es wird ein Mindestgebot (teilweise erst später nach Begutachtung) festgelegt
Je nach Auktionssparte, Auktionshaus und Wert der eingelieferten Ware kann bei manchen Einlieferungen dem Einlieferer ein Vorschuss auf den zu erwartenden Verkauf gewährt werden. Solche Vorschüsse, alle anfallenden Zinsen, Prüfspesen und andere Kosten, werden genauestens dokumentiert und bei der späteren Abrechnung nach der Auktion mit dem beim Verkauf erzielten Ertrag aufgerechnet.
Traditionelle Auktionshäuser veranstalten meist eine gewisse Anzahl von Auktionen im Jahr, bei denen Objekte aus verschiedenen Sparten (z. B. Porzellan, Möbel, Schmuck, Münzen, Gemälde usw.) angeboten werden, andere halten gesonderte Auktionen für einzelne Sparten ab oder sind generell auf eine bestimmte Ware spezialisiert. Mitunter werden aber auch besondere Auktionen veranstaltet, wenn etwa eine bestimmte Sammlung aufgelöst oder das Inventar eines ganzen Schlosses versteigert wird. Damit ist oft auch ein besonderer Werbeeffekt verbunden, wenn es sich um eine bekannte Sammlung handelt, zudem kann die nachweisbare Herkunft aus einer solchen den Wert des einzelnen Objekts erhöhen. Andererseits kann es aus Sicht des Auktionshauses auch sinnvoll sein, eine groÃÂe Sammlung ähnlicher Objekte bewusst nicht auf einmal zu veräuÃÂern, damit kein ÃÂberangebot entsteht, das zu niedrigeren Preisen führen kann.
ÃÂblicherweise finden traditionelle Auktionen in den Räumen des Auktionshauses statt, wo auch die zu versteigernden Objekte gelagert werden und vorher besichtigt werden konnten. Eine Auktion (und Vorbesichtigung) kann aber auch an einem anderen Ort stattfinden, z. B. wenn das Inventar eines Unternehmens versteigert wird â etwa groÃÂe Maschinen oder umfangreiche Warenbestände, die nicht demontiert bzw. transportiert werden können.
Material sichten und prüfen
Das eingelieferte Material wird von Fachexperten im Auktionshaus grob sortiert, detailliert gesichtet und geprüft. Dieser Vorgang kann in einem oder mehreren Schritten erfolgen. Anhand der Einschätzung der Experten wird die Entscheidung getroffen, wie das Material für die Auktion in Lose (auch Lot, Konvolut) aufgeteilt wird.
Ebenfalls in den Zusammenhang der Materialprüfung gehört die Recherche der Herkunft. So sollte bei verdächtigen Objekten eine ÃÂberprüfung durchgeführt werden, um eventuelles Diebesgut auszuschlieÃÂen. Hierzu werden etwa einschlägige Datenbanken wie das Art-Loss-Register durchsucht. Im Bereich von Kunst und Antiquitäten kann eine Untersuchung notwendig sein, ob die Provenienz einen Hinweis darauf geben könnte, dass es sich vielleicht um Raubkunst handelt.
Material beschreiben
Teilweise wird bei besonders wertvollen Losen von einem externen Sachverständigen ein Prüfzertifikat oder eine Expertise angefertigt, die der Ware beigelegt wird. Je nach Renommee des Experten kann besonders bei Kunstwerken der Wert durch ein positives Gutachten z. B. des maÃÂgeblichen Experten für einen bestimmten Künstler, ganz erheblich gesteigert werden.
Bei der Philatelie z. B. existieren sehr umfangreiche Kataloge, in denen Objekte beschrieben und teilweise bewertet werden. Beispiele solcher Kataloge sind der deutsche Michel-, der Schweizer Zumstein- oder der amerikanische Scott-Katalog. Bei Briefmarken oder Münzen ist die Erstellung solcher Kataloge möglich, weil die einzelnen Objekte meist keine absoluten Einzelstücke sind, bei Kunstwerken oder Antiquitäten handelt es sich dagegen in der Regel um Unikate deren Vergleich nur bedingt möglich ist. Für bestimmte Antiquitätengattungen (z. B. Möbel, Uhren oder Spielzeug) gibt es jedoch ebenfalls gedruckte Kataloge bei denen aber immer berücksichtigt werden muss, ob das zu bewertende Objekt tatsächlich mit dem im Katalog aufgeführten vergleichbar ist. Zudem existieren verschiedene Online-Preisdatenbanken die ebenfalls Auktionsergebnisse enthalten.
Die endgültige Bewertung der Ware übernimmt aber auch bei Gebieten, auf denen Kataloge vorliegen, stets ein Prüfer individuell. Er kann zudem beurteilen, ob bei früheren Auktionen für vergleichbare Objekte erzielte Preise als realistisch gelten können oder lediglich durch besondere Umstände (z. B. zwei Interessenten die sich gegenseitig immer wieder überboten haben) zu Stande gekommen sind. Auch zwischenzeitliche Marktveränderungen müssen berücksichtigt werden, da auch Kunst- und Antiquitätenmarkt in gewisser Weise von Moden geprägt sind die dazu führen, dass ein vor längerer Zeit gezahlter Preis heute unter Umständen nicht mehr realisierbar ist (oder umgekehrt).
Die Experten und Prüfer untersuchen das Material nach allen Auffälligkeiten und beschreiben nicht nur den Ursprung, sondern auch den Erhaltungszustand nach vorgegebenen Richtlinien. Oft werden auch die Prüfzertifikate als Grundlage für die Beschreibung der Ware im Auktionskatalog verwendet. Manche Auktionshäuser erstellen auf Anfrage auch gesonderte Zustandsberichte für einzelne Lose, die über die Angaben im Katalog hinausgehen. Wegen des Aufwandes ist dies aber meist nur für hochpreisige Objekte möglich.
Aufgrund der Beschreibung und dem Vergleich mit ähnlicher Ware geben die Experten einen mindestens zu erzielenden Schätzpreis ab. Hierbei werden in der Regel auch die Vorstellungen des Einlieferers berücksichtigt, allerdings gehört es auch zu den Aufgaben des Auktionshauses ihn über einen realistischen Preis zu informieren und überzogene Vorstellungen zu korrigieren. Dieser realistische Preis gilt als Grundlage für den Preis im Auktionskatalog, den man oft auch als Ausruf, Rufpreis oder auch Katalogpreis bezeichnet.
Bei Kunstauktionen wird oft nur eine Auktion für Teilgebiete abgehalten, so dass sich eine Einlieferung oft auf mehrere unterschiedliche Auktionen verteilt.
Katalogproduktion
Auktionshinweis an einer zu versteigernden baufälligen Immobilie in Rochlitz
Der Auktionskatalog gilt als die Visitenkarte eines Auktionshauses. Um diesen zu erstellen, ist sehr viel Aufwand notwendig. Es wird nicht nur die gesamte Ware so genau wie möglich beschrieben, sondern oft müssen die einzelnen Objekte auch im Katalog abgebildet werden. Auch hierzu bedienen sich renommierte Auktionshäuser Experten. In der Philatelie z. B. ist die Farbtreue zwischen dem Original und der Abbildung oft eine groÃÂe Herausforderung. Je nach Lichtverhältnissen und Materialbeschaffenheit können auch falsche Farben im Auktionskatalog erscheinen. Eine weitere Herausforderung der Katalogproduktion ist bisweilen auch die groÃÂe Anzahl der Auktionslose und Abbildungen in einem Katalog. Je nach GröÃÂe und Art der Auktion müssen manchmal bis zu 12.000 Lose in einem einzigen Katalog dargestellt werden. Bei Kunstauktionen ist die Anzahl der Lose jedoch oft sehr viel kleiner, wobei es aber auch hier Ausnahmen gibt, wie die legendäre Tek-Sing-Auktion im Stuttgarter Auktionshaus Nagel im November 2000 zeigte.
Mittlerweile ist es üblich geworden, dass auch traditionelle Auktionshäuser ihr Angebot zusätzlich zum gedruckten Katalog im Internet präsentieren. Oft entspricht dieser Online-Katalog dem gedruckten, unter Umständen geht er jedoch auch darüber hinaus, etwa durch zusätzliche Bilder. Vor allem bei kleineren Auktionshäusern, die weniger Aufwand für ihren gedruckten Katalog betreiben können, ist dies der Fall. Zudem gibt es Internet-Portale, über die alle aktuellen Online-Kataloge gezielt durchsucht werden können, so dass Sammler auch Kenntnis von Angeboten räumlich weit entfernter, kleinerer Auktionshäuser erlangen können.
Zirkulare bzw. Katalogbestellungen
Manche Auktionshäuser betreiben einen sehr groÃÂen Aufwand für die Erstellung von Auktionskatalogen. Diese dienen nicht selten auch als Grundlage für die Dokumentation von historischen Gegenständen, da die versteigerten Objekte nach dem Verkauf oft (zum Beispiel in einer Privatsammlung) nicht mehr zugänglich sind, der Katalog erhält somit auch einen wissenschaftlichen Wert. Da viele Sammler und Kunstinteressierte solche Publikationen mit oft einmaligen historischen Dokumentationen besitzen möchten ohne ein Objekt kaufen zu wollen, haben sich einige der führenden Auktionshäuser dazu entschlossen, für ihre Auktionskataloge eine Gebühr zu verlangen.
Ein Nebeneffekt ist, dass die Exklusivität der Auktionskataloge deutlich gestiegen ist und diese inzwischen bereits selbst zum begehrten Gegenstand vieler Sammlungen geworden sind. Oft erhält nur ein ausgewählter Teil der Kunden eines Auktionshauses einen Katalog gratis. Alle anderen bekommen ein Zirkular zugesandt, das mit einem Bestellschein für den Auktionskatalog zu vergleichen ist. Wenn Zirkulare versendet werden, dann geschieht dies lange vor der Katalogproduktion, um die Auflage besser abschätzen zu können.
ÃÂblicherweise werden aufwendige Kataloge eher von renommierten Auktionshäusern mit hochpreisigen Objekten herausgegeben, während sich bei kleineren Auktionshäusern der Umfang oftmals auf einen einfach gestalteten Katalog und auf Wunsch zugesandte detaillierte Digitalfotos beschränken kann.
Besichtigung des Materials
Vor jeder Auktion kann die Ware im Auktionssaal besichtigt werden. In den meisten Auktionshäusern werden dafür Besichtigungszeiten angeboten, die in der Regel einige Tage vor der Versteigerung liegen. Je nach räumlichen Gegebenheiten kann die Ware mitunter auch bis kurz vor dem Aufruf noch angesehen werden. Bei Ware, die nicht im Auktionshaus selbst gelagert werden kann (beispielsweise Fahrzeuge oder groÃÂe Maschinen), muss für die Besichtigung meist ein gesonderter Termin vereinbart werden.
Besonders kostbare, empfindliche und/oder diebstahlgefährdete Ware ist aus Sicherheitsgründen oft in Vitrinen ausgestellt und wird oft nur nach Vorlage von Ausweisdokumenten oder der Registrierung als Bieter zur genaueren Prüfung herausgegeben. Manchmal erhält der Interessent vor der Auktion eine Bieternummer, nur mit einer gültigen Nummer wird ihm die Ware zur Besichtigung ausgehändigt. Gleichzeitig wird für jedes besichtigte Los die Bieternummer dokumentiert, um im Fall einer Beschädigung oder sogar eines Diebstahls der Verursacher leichter ausfindig gemacht werden kann.
Oft übernehmen Kommissionäre die Aufgabe der Besichtigung. Sie werden von einem Interessenten beauftragt, die Ware zu prüfen und diese gegebenenfalls zu ersteigern. Dies ist zweckmäÃÂig, da Kommissionäre oft Fachleute sind. Sie prüfen den Wert der Ware und können aufgrund ihrer Einschätzung eine Gebotsempfehlung abgeben. Ersteigert ein Kommissionär die Ware für einen Auftraggeber, kann dieser anonym bleiben.
Bei Spitzenobjekten die von international tätigen Auktionshäusern angeboten werden ist es manchmal üblich das betreffende Stück vorher in verschiedenen Ländern in der Filiale des betreffenden Auktionshauses zu zeigen, wegen des groÃÂen Aufwandes geschieht dies jedoch nur bei Objekten im allerobersten Preissegment.[2]
Bieter
Um bei einer Auktion mitbieten zu können, müssen sich Bieter registrieren lassen, in einigen Fällen (siehe oben) auch schon bei der Besichtigung bestimmter Objekte. In vielen Auktionshäusern ist es mittlerweile üblich, dass zur Registrierung ein Ausweisdokument (Personalausweis, Reisepass) vorgelegt bzw. (bei schriftlichen oder Telefongeboten) in Fotokopie zugesandt werden muss. Manchmal wird auch die Angabe eines anderen Auktionshauses verlangt, bei dem der potentielle Bieter bereits Kunde ist, um ggf. Erkundigungen einziehen zu können. Auf diese Weise sollen Auktionshaus und Einlieferer vor Bietern geschützt werden, die Objekte ersteigern, aber nicht zahlen, sodass die Gegenstände erneut angeboten werden müssen.
Saalbieter
So werden die Bieter genannt, die persönlich an einer Auktion teilnehmen. Dies ist die traditionelle Form einer Auktion. Manche Bieter werden von einem Kommissionär oder Beauftragten vertreten, um ihre Anonymität zu wahren und damit den künftigen Aufenthaltsort der ersteigerten Ware vor der ÃÂffentlichkeit zu verschleiern. Tritt der Beauftragte dabei in eigenem Namen auf, ist dem Auktionator in der Regel der eigentliche Erwerber zwar theoretisch unbekannt, jedoch werden gerade in Sammlerkreisen solche Beauftragten recht schnell bekannt, was dann auch wieder einen Rückschluss auf den eigentlichen Erwerber zulässt.
Telefonbieter
Viele Auktionshäuser, vor allem in der Kunstbranche, bieten dem Kaufinteressenten die Möglichkeit, die Auktion (oder den für ihn relevanten Teil davon) am Telefon mitzuverfolgen und telefonisch mitzubieten. In der Regel ruft das Auktionshaus den Bieter an, sobald das ihn interessierende Los in der Auktion erreicht ist. Der Interessent wird dann wie ein im Saal Anwesender in den Bietvorgang einbezogen, jeweils über die Höhe der Gebote informiert und gefragt, ob er weiter mitbieten will.
Dies ist vor allem für Bieter interessant, die sonst weit anreisen müssten. Zudem bleibt die Anonymität des Käufers gewahrt, was vor allem bei besonders wertvollen Losen sinnvoll ist. Wegen des Aufwands bieten diesen Service aber nicht alle Auktionshäuser an, da Fachpersonal eingesetzt werden muss, oft auch mit Fremdsprachenkenntnissen. AuÃÂerdem beeinträchtigt diese Form der Auktionsbeteiligung in der Regel auch den sonst flüssigen und schnellen Auktionsablauf. Durch die Präsentation der Auktionskataloge im Internet hat die Nachfrage nach telefonischem Mitbieten in den letzten Jahren stetig zugenommen. Heute ist die überwiegende Mehrzahl der Kunstauktionshäuser darauf vorbereitet. Um den Auktionsablauf dennoch nicht zu behindern, wird dieser Service meistens nur für wertvolle Objekte, z. B. ab einem bestimmten Mindestpreis, angeboten; oft steht auch nur eine begrenzte Zahl von Telefonplätzen zur Verfügung so dass die Zahl der gleichzeitigen Telefonbieter begrenzt ist. Manchmal wird auch verlangt, dass Telefonbieter zusätzlich ein schriftliches âÂÂReservegebotâ abgeben, das nur berücksichtigt wird wenn die Telefonverbindung nicht zu Stande kommt oder abbricht.
Internet-Bieter
Neuerdings bieten viele Auktionshäuser die sogenannte âÂÂLive Auctionâ an. Bei diesem Verfahren können Bieter aus der ganzen Welt bequem von zuhause aus ihre Gebote bei einer Auktion über das Internet abgeben, wobei eine vorherige Registrierung notwendig ist. Diese Gebote werden dann von einem oder mehreren Mitarbeitern des entsprechenden Auktionshauses an den Auktionator weitergegeben, der das Gebot dann in die Auktion einbringt. Anders als feste schriftliche Gebote, die lediglich über das Internet vor der Auktion übermittelt werden, hat der Bieter bei der Live-Auktion die Möglichkeit, nachzubieten, sollte er überboten werden. Damit ähnelt diese Möglichkeit dem telefonischen Gebot, allerdings ist es dabei auÃÂerdem möglich, den Verlauf der gesamten Auktion zu verfolgen und auch spontan auf weitere Objekte zu bieten, während der Bieter beim Telefonbieten nur bei dem/den vorher vereinbarten Los(en) angerufen wird.
Auch bei diesem Verfahren bleibt die Anonymität des Bieters gewahrt. Auch sind Onlinegebote deutlich einfacher zu organisieren als Telefongebote. Dennoch können auch diese Online-Gebote den Ablauf einer Auktion verzögern.
Schriftliche Gebote
Viele traditionelle Auktionshäuser bieten die Möglichkeit, schriftlich an einer Auktion teilzunehmen, ohne persönlich bei der Auktion zu erscheinen. Dazu übergibt man dem Auktionshaus eine Aufstellung aller Lose, für die man bieten möchte, und dem höchsten möglichen Preis, den man bereit ist dafür zu bezahlen. Das Auktionshaus übernimmt dann die Funktion eines Treuhänders oder Bietagenten. Das bedeutet, dass immer im Sinn für den Bieter versucht wird, den günstigsten Preis zu erzielen. Jedoch kann ein schriftliches Gebot von anderen Bietern im Auktionssaal oder aber auch von anderen schriftlichen Bietern überboten werden. Ob das der Fall ist, erfährt man im Gegensatz zu den Online-Auktionen jedoch erst, wenn das Los im Auktionssaal aufgerufen wird. Bis dahin darf einzig und allein das Auktionshaus Kenntnis von den schriftlichen Geboten haben und muss darüber absolute Geheimhaltung bewahren. Liegen für ein Los zwei oder mehr gleich hohe schriftliche Gebote vor (und es erfolgen keine weiteren z. B. im Saal) so erhält meist das zuerst abgegebene den Zuschlag, andere Auktionshäuser lassen in solchen Fällen auch das Los entscheiden.
Bereits vor der Auktion, aber auch während der Auktion, die sich teilweise über mehrere Tage hinziehen kann, können schriftlich Gebote abgegeben werden. Bei vielen Auktionshäusern können schriftliche Gebote nicht nur per Post oder Fax, sondern auch über das Internet abgegeben werden, diese Möglichkeit ist aber zu unterscheiden von Online-Live-Geboten (siehe unten), bei denen der Bieter unmittelbar in der Auktion bietet.
Schriftliche Gebote können zwei besondere Merkmale enthalten:
Gebote mit einem Maximal-Limit:
Wenn ein Bieter für mehrere Lose schriftlich bietet, kann er davon ausgehen, dass er nicht für jedes Los der Höchstbietende ist und für sein Maximalgebot auch den Zuschlag erhält. Daher hat er bei vielen Auktionshäusern die Möglichkeit mitzuteilen, wie viel er maximal in einer Auktion ausgeben möchte. Gleichzeitig kann er jedoch für ein Vielfaches dieses Limits über mehrere Lose hinweg bieten. Es ist dann die Aufgabe des Auktionshauses, darüber zu wachen, dass das maximale Limit des Bieters nicht, oder zu einem vorher vereinbarten Maximum überschritten wird. Es werden ihm nur so viele Lose zugeschlagen, bis das Budget des Bieters aufgebraucht ist, oder alle seine Gebote abgearbeitet sind.
Oder-Gebote:
Manchmal werden mehrere Lose angeboten, die eigentlich gleich sind. Ein Sammler möchte oft aber nur eines dieser Lose haben. Er kann dann bei vielen Auktionshäusern auch schriftlich für alle diese Lose bieten und dem Auktionshaus mitteilen, dass er aber nur eines der Lose haben möchte. Sobald dem Bieter eines der Lose zugeschlagen wird, ist das Auktionshaus verpflichtet, alle weiteren Gebote dieser âÂÂOder-Serieâ zu verwerfen.
Auktionsführung
Viele Auktionshäuser führen ein ausgedrucktes Auktionsbuch, das neben den Losdaten wie Ausruf bzw. Schätzpreis noch weitere Einträge zum Einlieferer, Anmerkungen, schriftliche Gebote sowie Zuschläge mit der jeweiligen Bieternummer enthält. Zur Organisation einer Auktion gehört zudem das Sammeln und Verwalten von vorgegebenen Mindestgeboten sowie âÂÂOderâÂÂ-Geboten und Maximal-Limits von Bietern in der Auktion, wofür nicht selten ein erheblicher Aufwand notwendig ist. Zur Erleichterung der ÃÂberwachung einer hohen Zahl von Geboten, die auf verschiedenen Kanälen eintreffen können, werden diese Daten elektronisch erfasst und liegen dann dem Auktionstisch aufbereitet vor. Hier können bis kurz vor dem Aufruf noch schriftliche Gebote abgegeben werden. Zuschläge werden sofort erfasst, worauf in der Regel schnell die Bezahlung und Aushändigung der Ware erfolgen kann. Manche Auktionshäuser zeigen auf Displays die Umrechnung der Gebote in Fremdwährungen an.
Die Versteigerungsbedingungen
Die Versteigerungsbedingungen müssen vor und während der Auktion für jedermann zugänglich sein und auch im Auktionssaal ausliegen. In der Regel sind die Versteigerungsbedingungen bereits im Auktionskatalog abgedruckt. Ebenso ist der Auktionator verpflichtet, vor der Auktion auf die Versteigerungsbedingungen und deren Zugänglichkeit hinzuweisen, er muss diese Versteigerungsbedingungen auch bei sich haben.
Anwesenheit eines Beamten bei Auktionen in der Schweiz
In der Schweiz ist es üblich bzw. Pflicht, dass bei einer Auktion ein Stadtbeamter anwesend ist. Dieser dokumentiert unabhängig vom Auktionshaus die Auktion im Saal und kann bei Streitfragen schlichtend einschreiten. In Deutschland ist diese amtliche Auktionsbegleitung unüblich.
Zuschlag
Ein Los wird solange ausgerufen, bis sich kein höheres Gebot findet. Dabei hält sich der Auktionator an vorher festgelegte Steigerungsstufen, die ab der Höhe des Ausrufes erfolgen. Es können auch höhere Gebote im Saal ausgesprochen werden, ab denen dann die weitere Steigerung fortgesetzt wird. Liegen schriftliche Gebote vor, wird ein Auktionator den Ausruf im Saal an die höchste Steigerungsstufe der schriftlichen Gebote anpassen. Das bedeutet bei Geboten über dem veröffentlichten Ausruf, eine Steigerungsstufe über dem zweithöchsten Gebot, sofern dieses nicht das schriftliche Höchstgebot übersteigt, ansonsten erfolgt der Ausruf zum schriftlichen Höchstgebot. Das höchste schriftliche Gebot wird solange gegen den Saal geboten, bis entweder im Saal ein höheres Gebot abgegeben wird oder das schriftliche Höchstgebot den letzten ausgerufenen Preis im Saal übersteigt. Der Auktionator übernimmt im Fall der schriftlichen Gebote die Funktion eines Bietagenten. Liegen zwei gleich hohe schriftliche Höchstgebote vor, so erhält bei manchen Auktionatoren dasjenige den Zuschlag, das zuerst abgegeben wurde, andere Auktionatoren bedienen sich eines Zufallsentscheides zum Beispiel durch den ersten Zuruf aus dem Publikum. Die Art und Weise des Zuschlags kann unterschiedlich erfolgen. Bei Auktionen mit geringen Stückzahlen wird das letzte Gebot bis zu dreimal ausgerufen und mit dem Klopfen des Auktionshammers abgeschlossen. Bei sehr umfangreichen Auktionen wird auch schon mal auf diese Form verzichtet und einfach nur nachgefragt, ob niemand mehr höher bieten möchte. Der Zuschlag wird bei traditionellen Auktionen immer mit einem Klopfen des Auktionshammers abgeschlossen.
Unter Vorbehalt der Nachprüfung
Dies bedeutet, dass eventuell einem Bieter oder Bietagenten während der Besichtigung eines Loses mögliche Ungereimtheiten aufgefallen sind und er dieses Los noch einmal von einem Fachmann genauer unter die Lupe nehmen lassen möchte. Dadurch soll geprüft werden, ob mit der Ware alles in Ordnung ist, bzw. der geschätzte Preis, zu dem ein Los aufgerufen wird, auch wirklich dem entspricht, was es tatsächlich wert ist. Manchmal können Manipulationen an einem Los nicht gleich auf Anhieb erkannt werden, die u. U. den tatsächlichen Wert deutlich mindern würden, bzw. sogar die Echtheit in Frage stellen. In diesem Fall informiert er das Auktionshaus darüber. Sofern sein Einwand auch aus Sicht des Auktionshauses berechtigt ist, wird dann das Los im Auktionssaal, âÂÂunter Vorbehalt der Nachprüfungâ ausgerufen und zugeschlagen. Der Auktionator muss dies in solchen Fällen vor Ausruf eines solchen Loses im Auktionssaal ankündigen und alle anwesenden Bieter über den Einwand informieren. Stellt sich im Nachhinein tatsächlich heraus, dass mit dem Los etwas nicht stimmt, und die Höhe des Ausrufes ungerechtfertigt bzw. zu hoch angesetzt war, wird der Zuschlag nachträglich wieder zurück- und das Los im Nachhinein aus der Auktion wieder herausgenommen.
âÂÂWie es istâÂÂ
Wird während der Besichtigung berechtigt der Zustand oder der Wert eines Loses bemängelt, haben die Auktionshäuser auch die Möglichkeit, ein Los zu verkaufen, âÂÂwie es istâÂÂ. In solchen Fällen wird, sofern der Einlieferer darüber informiert wurde und dem zustimmt, oft der angesetzte Ausruf verworfen und die anwesenden Bieter können ihre Gebote auch unter dem vorher festgesetzten Ausruf abgeben. In jedem Fall muss der Auktionator dies vor Ausruf eines solchen Loses im Auktionssaal ankündigen und alle anwesenden Bieter über den Einwand und die festgestellten Hintergründe informieren. In diesem Fall werden alle schriftlichen Gebote auf dieses Los verworfen, da die Beschreibung im veröffentlichten Auktionskatalog falsch ist und schriftliche Bieter ihre Gebote unter falschen Voraussetzungen abgegeben haben.
Unter Vorbehalt der Zustimmung
Manchmal findet sich kein Bieter, der bereit ist, ein Los zum ausgerufenen Wert (Ausruf bzw. Schätzpreis) zu erwerben. Sofern ein Auktionshaus die Möglichkeit bietet, auch Gebote unter dem Ausruf abzugeben, dann aber das Höchstgebot immer noch eine bestimmte Differenz überschreitet, kann ein Auktionator auch ein Gebot âÂÂunter Vorbehaltâ (UV) annehmen. Ob dies möglich ist, wird in den individuellen Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses festgelegt. In solchen Fällen werden zwar das Höchstgebot und der Bieter im Auktionssaal erfasst, das Los gilt aber dennoch nicht als zugeschlagen. Erst wenn der Einlieferer einem solchen Zuschlag zustimmt, gilt das Los als verkauft. Man nennt solche Lose auch UV-Lose.
Zuschlag von schriftlichen Geboten nach der Auktion
Je nach Auktionsführung kann es sein, dass Gebote auf Lose, die nicht im Auktionssaal aufgerufen wurden, weil im Saal kein Interesse für diese Lose bestand, erst noch zugeschlagen werden müssen. Dieses Verfahren entspricht zwar nicht ganz dem Prinzip eines traditionellen Auktionshauses, ist aber bei Auktionen mit groÃÂen Stückzahlen manchmal notwendig, um den Auktionsverlauf im Saal nicht allzu sehr in die Länge zu ziehen. Als Beispiel können hier Briefmarken- oder Ansichtskartenauktionen aufgeführt werden, bei denen in der Regel mehrere tausend Lose, manchmal auch über 10.000, angeboten werden. Der Zuschlag kann entweder manuell vom Auktionator, oder automatisiert vom Auktionssystem erfolgen.
Nach der Auktion
Rechnungsstellung und Versand der Ware
Nach der Auktion, sobald die letzten Gebote zugeschlagen wurden, werden den schriftlichen Bietern ihre zugeschlagenen Lose in Rechnung gestellt. Der Versand der Ware erfolgt üblicherweise nach Zahlungseingang. In manchen Fällen, wenn ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Auktionshaus und dem Bieter besteht, wird die Ware auch gleich mit der Rechnung zugesendet. Neben dem Zuschlag wird dem Bieter noch eine Provision, auch Kommission genannt, und je nach Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses auch eine Losgebühr berechnet. Abhängig von der Art des Auktionshauses, also ob das Auktionshaus im eigenen Namen, oder im Auftrag arbeitet und abhängig von wem das Los stammt, kommt noch zusätzlich die anfallenden Umsatzsteuer auf das Los dazu. Die Summe der oben genannten Aufschläge wird in Deutschland üblicherweise als Aufgeld bezeichnet. Daher müssen Bieter bei der Abgabe eines Gebotes berücksichtigen, dass sich der zu zahlende Endpreis noch um das Aufgeld erhöht. Bei wenigen Auktionshäusern ist das Aufgeld jedoch schon im Mindestpreis bzw. jeweiligen Gebot enthalten, so dass der Bieter nur den gebotenen Betrag zahlen muss (abgesehen von Kosten für Transport o. ÃÂ.).
Die umsatzsteuerliche Berechnung kann in der Praxis in Deutschland von Auktionshaus zu Auktionshaus unterschiedlich gehandhabt werden:
Versteigerung im eigenen Namen:
Da es sich bei vielen versteigerten Artikeln um Ware handelt, die man als Kulturgut bezeichnet, fällt auf die Lose selbst in der Regel der ermäÃÂigte Steuersatz an. Die Leistungen des Auktionshauses wiederum werden mit dem Normalsatz der Umsatzsteuer berechnet. In einigen Fällen wird der ermäÃÂigte Steuersatz aber auch auf die gesamte Rechnung des Auktionshauses angewendet. Andere wiederum splitten die Rechnung auf und berechnen unterschiedliche Sätze.
Versteigerung im Auftrag:
Diese Form der Versteigerung ist für ein Auktionshaus mit der aufwendigsten Abrechnungsform verbunden, sofern das Auktionshaus international agiert. Hierbei kommt es aus steuerlicher Sicht zu einem direkten Geschäftsverhältnis zwischen dem Einlieferer und dem Bieter/Käufer. Abhängig davon, ob der Einlieferer gewerblich handelt oder die Ware von privat verkauft, wird dem Bieter die Umsatzsteuer berechnet. Ebenso werden die Importumsatzsteuer bei gewerblichen Einlieferern aus Drittländern (Nicht EU), bzw. die Einfuhrspesen und die Umsatzsteuer auf diese weiterberechnet. Die Umsatzsteuer auf die Provision und sonstige Gebühren des Auktionshauses fallen immer an, da die Geschäftsabwicklung und damit diese Leistung in Deutschland erbracht werden. Händler aus EU-Ländern werden in der Regel ihre Ware nicht direkt anbieten. Da das Geschäft in Deutschland abgewickelt wird, würden sie dann auch in Deutschland steuerpflichtig, d. h., sie müssten hier eine eigene Steuernummer beantragen und eine Steuererklärung abgeben. Daher liefern EU-Händler dann meistens über einen deutschen Händler ein, womit dann die Regelung eines Deutschen Händlers zum Tragen kommt.
Umgekehrt gilt die Regelung auch für die Bieter im Ausland. Je nach dem, woher der Bieter kommt, bzw. wohin die Lose geliefert werden, kann die Mehrwertsteuer auf die Lose entfallen. So z. B. für gewerbliche Ware aus dem Inland und der EU, die an einen gewerblichen Käufer in der EU mit einer EU-Umsatzsteuer-ID geht oder die in ein Drittland (Nicht-EU) exportiert wird. Käufer aus Drittländern, die ihre Ware selbst abholen, sind grundsätzlich umsatzsteuerpflichtig, können aber bei Rücksendung eines Ausfuhrbeleges die Umsatzsteuer für die Lose im Nachhinein wieder gutgeschrieben und ausgezahlt bekommen. Stammt die Ware, die ein Drittland-Kunde erwirbt, selbst aus einem Drittland, so fallen für ihn sowohl die Einfuhrsteuern und Zölle, als auch die Ausfuhrkosten an. Dem wiederum begegnen einige Auktionshäuser mit einem Zolllager, bei dem die Ware offiziell erst dann nach Deutschland eingeführt wird, wenn die Ware nach Deutschland oder in die EU verkauft wird. Ebenso wird die Berechnung der Einfuhrspesen von den Zollämtern unterschiedliche gehandhabt. Einige setzen für die Berechnung der Einfuhrumsatzsteuer den Schätzwert an, der später auch im Katalog als Ausruf erscheint, da diese sofort abgeführt werden muss. Andere bestehen als Berechnungsgrundlage auf den Betrag des erst später erfolgten Zuschlags. Liefert ein Drittlandkunde die Ware persönlich im Auktionshaus ein, gilt diese als Inlandsware.
Aus diesen Gründen erfolgt die steuerliche Berechnung auf einer einzigen Bieter-Rechnung in der Regel für jedes Los gesondert.
Kurzum: in der steuerlichen Regelung besteht in Deutschland kein einheitlicher Konsens, was vermutlich auch daran liegen mag, dass die steuerliche ÃÂberprüfbarkeit je nach Art und Umfang einer Versteigerung kaum noch nachvollziehbar ist und in der Praxis nahezu undurchführbar wird, bzw. zu kompliziert und zu aufwendig ist. Zurzeit wird darüber diskutiert, ob man für international agierende Auktionshäuser die Differenzbesteuerung einführen soll. Wie dann allerdings eine Umsatzsteuerprüfung vonstattengehen soll und was dann letztlich mit welchem Aufwand geprüft wird, ist mehr als nur fraglich. Man darf daher auch in Deutschland von einem gewissen steuerlichen Chaos sprechen, auch wenn dies viele Finanzbeamte nicht wahr haben wollen. Fragt man sie dann aber konkret und gezielt nach bestimmten Fallbeispielen, geben die meisten über kurz oder lang auf und suchen nach einer tragbaren Lösung für eine individuelle steuerliche Abrechnungsform oder verweisen auf das Bundesfinanzministerium. Daher kommen auch die vielen verschiedenen Abrechnungssysteme bei deutschen Auktionshäusern.
Reklamationen
Ist ein schriftlicher Bieter nach Erhalt der Ware nicht mit deren Zustand einverstanden oder will die Ware doch nicht haben, kann er bei der Versteigerung nach ç 156 BGB in Deutschland nicht wie bei einem Fernabsatzvertrag die Ware gemäàden Regelungen der çç 312 ff., 355 ff. BGB zu Fernabsatzverträgen wieder zurücksenden. Kommt es zu einem Streitfall, versucht daher immer zuerst das Auktionshaus, die Angelegenheit zu schlichten. Sollte dies nicht möglich sein, müssen sich die beiden Parteien (Einlieferer und Bieter/Käufer) direkt einigen und notfalls ihren Konflikt selbst vor den entsprechenden rechtlichen Instanzen austragen. Manchmal kann es auch aufgrund solcher Streitereien, je nach Sachlage und Situation, zur Sperrung einer der Parteien für künftige Auktionen kommen. Dies dann nicht selten auch bei anderen Auktionshäusern, sofern diese in einem Verband zusammengeschlossen sind und sich untereinander informieren.
Nachverkauf
Bei vielen Auktionshäusern ist heute ein Nachverkauf der unverkauften Lose, eine Zeit lang nach der Auktion, üblich. Viele Häuser veröffentlichen dazu extra sogenannte Rückloslisten oder bieten die Waren gleich in einem Online-Shop an. Der Preis richtet sich dabei entweder am Mindestgebot oder dem Ausruf. Oftmals wird ein fester prozentualer Anteil vom Ausruf abgezogen und dieser Preis dann als Verkaufspreis ausgegeben. Manchmal ist es auch möglich, für nicht verkaufte Objekte ein Untergebot abzugeben, das dann dem Einlieferer zur Entscheidung vorgelegt wird. Aber auch im Nachverkauf bleibt der Auktionator dem Einliefer verpflichtet und ist gehalten, den höchstmöglichen Preis zu erzielen.
Der Nachverkauf erfüllt nicht die Anforderungen der deutschen Rechtsprechung an die öffentliche Versteigerung. Darum gelten hier nicht die Privilegien der Versteigerung (Ausnahmen von den Regelungen des Fernabsatzes, Ausschluss der Gewährleistung, gutgläubiger Erwerb), auÃÂer die Geschäftsbedingungen des Auktionshauses legen eine andere Regelung ausdrücklich fest.
Einliefererabrechnung
Abhängig von den Versteigerungsbedingungen wird in einer definierten Zeit nach der Auktion die Abrechnung der verkauften Ware mit den Einlieferern durchgeführt. Von dem Zuschlag wird dem Einlieferer eine Kommission abgezogen. Ebenso ist es bei einigen Auktionshäusern üblich, dem Einlieferer eine zusätzliche Losgebühr oder Gebühren für die Abbildung im Auktionskatalog in Rechnung zustellen. Manche Auktionshäuser berechnen den Einlieferern auch ein Aufwandsgebühr für die nicht verkauften Lose. Dazu kommen noch die Versicherungsgebühren, die sich in der Regel an der Höhe des Ausrufes mit einem festen Prozentsatz orientieren. Von dieser Gutschrift werden dem Einlieferer auch noch angefallene Aufwendungen für Testate, Transportkosten oder gewährte Vorschüsse samt Zinsen abgezogen. Das sich daraus ergebende Restguthaben wird dann dem Einlieferer ausbezahlt oder mit anderen Rechnungen verrechnet. Für die Einliefererabrechnung gelten die gleichen Umsatzsteuerregelungen, wie sie weiter oben für die Bieterrechnungen beschrieben wurden. Je nach Art der Versteigerungsform kann diese ebenfalls sehr umfangreich und komplex aufgebaut sein (z. B. bei einer Versteigerung im Auftrag).
Unverkaufte Lose
Je nach Vereinbarung des Einlieferers mit dem Auktionshaus werden die unverkauften Lose entweder unmittelbar nach der Auktion oder nach Ablauf der Nachverkaufsphase an den Einlieferer zurückgegeben. In vielen Fällen verbleibt aber die Ware im Auktionshaus und wird in der nächsten Auktion wieder zu einem (möglicherweise) ermäÃÂigten Wert erneut ausgerufen.
Als verbrannt gelten jene Objekte, die häufig binnen weniger Monate mehrmals in Auktionen (womöglich auch verschiedener Auktionshäuser) eingereicht wurden und liegengeblieben sind. Ursache ist häufig eine anfänglich zu hohe Erwartung des Verkäufers, die dann von potentiellen Käufern als (womöglich verdeckter) Mangel gedeutet wird. Ein marktüblicher Preis ist oftmals erst nach vielen Jahren wieder zu erzielen.
Allerdings gehört es auch zu den Aufgaben eines Auktionshauses, den Einlieferer über den erzielbaren Marktwert zu informieren und einen realistischen Ausrufpreis festzusetzen.
Lose, die trotz eines erfolgten Zuschlags bereits nach kurzer Zeit wieder in einer Auktion angeboten werden, lösen ebenfalls Misstrauen aus. Hier entsteht der Verdacht, dass es einen verdeckten Mangel gibt, den der Käufer entdeckt hat und das Objekt daher schnell wieder loswerden möchte. Auch erscheint es denkbar, dass unerlaubterweise ein vom Verkäufer (oder Einlieferer) beauftragter Lockvogel den Preis durch Gebote nach oben zu treiben versucht hatte, dabei aber ungewollt den Zuschlag erhalten hat, so dass das Stück nun erneut angeboten wird.
Online-Auktion
Die Online-Auktion wird per Internet veranstaltet. Bekanntester Veranstalter von Online-Auktionen ist eBay; auch bekannt sind z. B. in Deutschland Hood.de und in der Schweiz ricardo.ch. Nach erfolgter Auktion gelangt die Ware in der Regel mittels Versand zum Kunden; bezahlt wird meist per ÃÂberweisung, per Nachnahme oder bar bei Abholung. Als Online-Auktion im weiteren Sinne gibt es auch sogenannte Dienstleistungsauktionen (z. B. MyHammer.de), unternehmensinterne Auktionen, Penny-Auktionen, Niedrigstpreis-Auktionen und Forderungsauktionen (versteigert werden titulierte Forderungen oder Forderungspakete). Manche Online-Plattformen bieten auch ausschlieÃÂlich Auktionen für den guten Zweck an (z. B. United Charity).
Wegen der groÃÂen Anzahl von Online-Auktionshäusern und der daraus folgenden Unübersichtlichkeit hat sich auch ein breites Angebot an Dienstleistungen rund um diese Auktionsform gebildet. Dazu zählen Metasuchmaschinen für Angebotssuche, aber auch viele Serviceprogramme zum Offline-Erstellen von Angeboten und Auktionsverwaltung. Personen, die keinen eigenen Computer oder keine Zeit haben, selbst eine Internet-Auktion zu starten, können ihre Waren in speziellen Shops abgeben. Diese versteigern dann die Ware gegen Provision.
In Deutschland handelt es sich bei einer Online-Auktion nicht um eine Versteigerung im Sinne des ç 156 BGB, sodass Verkäufer nicht unter den Schutz dieser Gesetzgebung fallen. Hierbei kann es zu Betrug zu Lasten gutgläubiger Käufer kommen.[3]
Siehe auch: Abbruchjäger
Internet-Live-Auktion
Die Internet-Live-Auktion ist eine von einem Auktionshaus über das Internet veranstaltete, behördlich autorisierte Versteigerung im Sinne des ç 156 BGB und ç 34b Gewerbeordnung (GewO), bei der alle Gebote in Echtzeit digital verarbeitet werden. Sie erfolgt nach dem Vorbild traditioneller Auktionen, eine Teilnahme im Sinne von ç 156 BGB ist jedoch zusätzlich mittels Personal Computer, Notebook, Tablet PC und Smartphone möglich. Daher können sowohl im Saal anwesende als auch über das Internet angebundene Personen mitbieten.
Bekanntester Veranstalter von Internet-Live-Auktionen war die Auctionata AG in Berlin, die Anfang 2017 Insolvenz anmelden musste.[4] Der Unterschied zu Online-Auktionen besteht u. a. in der gesetzlichen Absicherung der Versteigerung, sodass Käufer im Gegensatz zur typischen eBay-Auktion kein Widerrufsrecht gemäàFernabsatzvertrag haben. Internet-Live-Auktionen werden von einem Auktionator geleitet und mittels Live-Stream über das Internet übertragen. Auch viele kleinere Auktionshäuser bieten (meist über ein Verbundportal) diesen Service an, so dass nicht nur Kunden im Saal, sondern auch Internetbieter an einer Versteigerung teilnehmen können.
Auftragsauktion
Die Auftragsauktion, auch Jobauktion oder Dienstleistungsauktion genannt, ist eine Form der Ausschreibung, bei der der Nachfrager eine Leistung beispielsweise von einem Handwerker erbracht haben möchte und einen Höchstpreis vorgibt. Anbieter der nachgefragten Leistung versuchen sich gegenseitig zu unterbieten, um an den Auftrag zu gelangen. Dadurch fallen die Gebote im Verlauf der Auktion â Auftragsauktionen sind Rückwärtsauktionen. Bei unternehmensinternen Auktionen bieten verschiedene Teileinheiten, um beispielsweise den Zuschlag für die Umsetzung eines Produktionsauftrags zu bekommen. Wird eine Auftragsauktion im Internet durchgeführt, spricht man von einer E-Reverse Auction.
Unterschiedliche Gebotssysteme
Auktionen können nach unterschiedlichen Kriterien klassifiziert werden.
Einseitige und zweiseitige Auktionen
Bei einseitigen Auktionen werden Gebote entweder nur von Kaufinteressenten oder nur von Verkaufsinteressenten abgegeben. Bei zweiseitigen Auktionen bieten sowohl Käufer als auch Verkäufer, und passende Gebote werden zusammengeführt. Ein Beispiel für eine zweiseitige Auktion ist eine Börse.
Offene und verdeckte Auktionen
Teilnehmer einer offenen Auktion wissen, welche Gebote bisher abgegeben wurden (möglicherweise allerdings nicht von wem). Die klassische Versteigerung ist eine offene Auktion. Offene Auktionen können aufsteigend oder absteigend sein.
Teilnehmer einer verdeckten Auktion (auch stille Auktion genannt) geben ihre Gebote ohne dieses Wissen ab. Die Gebote werden nicht ausgerufen, sondern verdeckt abgegeben â beispielsweise per Post oder in einer Urne. Zu einer vereinbarten Zeit wird die Auktion geschlossen und derjenige gewinnt die Auktion, der das höchste Gebot abgegeben hat. Bei gleichen Geboten bekommt der Bieter des früheren den Zuschlag.[5] Bei verdeckten Auktionen werden zwei Varianten unterschieden:
Erstpreisauktion: Bei der Erstpreisauktion (engl. first price sealed bid auction), auch Höchstpreisauktion genannt, gibt jeder Nachfrager ein verdecktes Gebot ab. Das beste Gebot erhält den Zuschlag, und der Gewinner leistet eine Zahlung in Höhe seines Gebots.
Zweitpreisauktion: Bei der Zweitpreisauktion (engl. second price sealed bid auction), auch Vickrey-Auktion genannt, erhält ebenfalls der Höchstbieter den Zuschlag, zahlt aber nur in Höhe des zweithöchsten Gebots. Der Vorteil dieser Auktion gegenüber der Erstpreisauktion besteht darin, dass es für Bieter vorteilhaft ist, ein Gebot in Höhe ihrer wahren Wertschätzung für das zu versteigernde Gut abzugeben, während sie bei der Erstpreisauktion niedriger bieten werden, um im Falle des Zuschlags noch einen Gewinn zu haben.
Aufsteigende Gebote: englische Auktion und japanische Auktion
Die englische Auktion ist die bekannteste Form der Auktion. Dabei werden, von einem festgesetzten Mindestpreis ausgehend, aufsteigend Gebote abgegeben, bis kein neues Gebot mehr eintrifft. Der letzte Bieter erhält den Zuschlag.
Bei der japanischen Auktion erhöht der Auktionator stetig den Preis, während nach und nach Bieter aussteigen, so lange, bis nur noch ein Bieter übrig ist.[6] Die Auktion ist, wie die englische Auktion, das strategische ÃÂquivalent zur Zweitpreisauktion.
Absteigende Gebote: Rückwärtsauktionen
Niederländische Auktion: Der sinkende Kaufpreis ist am Zeiger erkennbar, der sich im Uhrzeigersinn dreht
Bei einer Rückwärtsauktion (engl. reverse auction) werden absteigende Beträge genannt â die Gebote fallen. Je nach Modus wird entweder ein höchster Preis oder ein möglichst niedriger Preis gesucht:
Bei einer niederländischen Auktion werden absteigende Beträge genannt, bis ein Erster auf das aktuelle Angebot eingeht. In diesem Fall wird ermittelt, welcher Käufer den höchsten Preis zu zahlen bereit ist. Wegen des sofortigen Zuschlags werden niederländische Auktionen sehr schnell abgewickelt. Dieses Verfahren eignet sich bei mehreren gleichartigen Artikeln, wie etwa Tabakerntehaufen.
Bei Auftragsauktionen wird mit fallenden Geboten über einen längeren Zeitraum ermittelt, welcher Anbieter bereit ist, die vom Interessenten nachgefragte Leistung für den niedrigsten Preis zu erbringen. In der Praxis (z. B. bei MyHammer) ist der Auftraggebende teilweise nicht verpflichtet, den Anbieter mit dem niedrigsten Preis zu wählen. Er kann frei entscheiden, welchem Anbieter er den Zuschlag gibt (gute Bewertung, Ortsnähe etc. haben hier auch eine groÃÂe Bedeutung). Eine E-Reverse Auction ist eine Rückwärtsauktion, die im Internet veranstaltet wird. Auftragsauktionen und insbesondere Beschaffungsauktionen im Business-to-Business-Bereich werden meist als E-Reverse Auction durchgeführt.
Kombinatorische Auktion
Stehen mehrere unterschiedliche Güter zum Verkauf, kann eine Auktion Gebote zulassen, die einen Preis für mehrere Güter in ihrer Gesamtheit bieten. Eine solche kombinatorische Auktion hat den Vorteil, dass Bieter nicht dem Risiko, nur einen für sie wertlosen Teil der von ihnen benötigten Güter zu ersteigern, ausgesetzt sind. Ihr Nachteil besteht darin, dass die Gewinnerermittlung komplizierter ist als bei der klassischen Einzelauktion.
Sonderformen
Amerikanische Versteigerung
Bei einer amerikanischen Versteigerung zahlt jeder Bieter jeweils sofort den Differenzbetrag zwischen seinem Gebot und dem Vorgängergebot. Dadurch werden oft Einnahmen erzielt, die weit über dem Wert des zu versteigernden Gegenstandes liegen. Amerikanische Versteigerungen werden in der Regel zugunsten gemeinnütziger Zwecke durchgeführt.
Die amerikanische Versteigerung ist die bekannteste Form der All-pay-Auktion. Bei einer All-pay-Auktion erhält der Bieter mit dem Höchstgebot den Zuschlag, aber alle Bieter zahlen.
Zwei Bieter zahlen
In manchen Wirtschaftsspielen zur Erforschung von wirtschaftspsychologischen Fragestellungen erhält der Höchstbieter den Zuschlag und muss bezahlen, aber auch der Bieter mit dem zweithöchsten Gebot muss sein Gebot bezahlen. Dadurch eskaliert die Situation, weil der jeweils Unterlegene nicht leer ausgehen will. Die Gebote steigen dabei oft in ungewollt hohe Gebiete.
Calcutta-Auktion
Eine Calcutta-Auktion ist eine Kombination aus einer Lotterie und einer Auktion. Die Calcutta-Auktion ist eine vor allem in den USA und den Ländern des früheren British Empire beliebte Wettart, die bei Pferderennen in Calcutta erfunden wurde.
Rechtliche Grundlagen
In Deutschland wird eine Versteigerung von ç 156 BGB geregelt. Bei gewerblichen Versteigerungen findet auÃÂerdem ç 34b GewO und die Verordnung über gewerbsmäÃÂige Versteigerungen Anwendung.
Auch bei sogenannten Internetversteigerungen kommt grundsätzlich ein gültiger Vertrag zustande.[7]
Das OLG Frankfurt hat auÃÂerdem entschieden[8], dass die Bezeichnungen âÂÂAuktionâ oder âÂÂVersteigerungâ für Verkäufe gegen Höchstgebot im Internet, die keine Versteigerungen i. S. v. ç 34b GewO sind, ohne Hinzutreten weiterer Umstände nicht irreführend sind.
Allerdings handelt es sich bei diesen Auktionen nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht um Versteigerungen im Sinne von ç 156 BGB, da kein Zuschlag im Sinne dieser Vorschrift erfolgt. An der dafür notwendigen Willenserklärung eines Auktionators fehle es bei Internetauktionen.[9] Auf Internetauktionen finden ç 156 BGB, ç 34b GewO und die Verordnung über gewerbsmäÃÂige Versteigerungen keine Anwendung.[10] Internetauktionen werden somit nicht von der Ausnahmeregelung des ç 312d Abs. 4 Nr. 5 BGB erfasst â daher steht Verbrauchern gem. ç 13 BGB, die auf diese Weise mit einem Unternehmer einen Fernabsatzvertrag abgeschlossen haben, grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.[11]
Ebenso handelt es sich nicht um eine Versteigerung im Sinne des ç 34b GewO, weswegen man keine behördliche Erlaubnis zum Veranstalten von Internetauktionen benötigt.
Verboten ist bei allen Auktionen die Gebotstreibung oder englisch shill bidding (von engl. shill: Lockvogel, AnreiÃÂer; to bid: bieten), bei der eine vom Versteigerer (oder Einlieferer) engagierte Person als Lockvogel versucht, den Preis durch Gebote in die Höhe zu treiben. In der Anfangszeit der Online-Auktionen war dies ein besonderes Problem, da durch die Anonymität sogar der Verkäufer selbst über einen zweiten Account auf seine angebotenen Artikel bieten konnte. Mittlerweile versuchen die Online-Auktionshäuser durch Anzeige von Verkaufs- und Bietaktivität mögliche unerlaubte Verbindungen zwischen einzelnen Mitgliedern sichtbar zu machen und damit diese Form des Betrugs auszuschlieÃÂen.
Tätigkeit als Auktionator
Im Gegensatz zu anderen Ländern gibt es in Deutschland den Beruf des Auktionators im klassischen Sinne nicht, ebenso wenig wie eine Ausbildung. Auktionatoren üben in Deutschland vielmehr eine gewerbsmäÃÂige Tätigkeit aus, die der Gewerbeordnung unterliegt. Benötigt wird eine Versteigerererlaubnis nach ç 34b GewO, die über das Ordnungsamt der Heimatbehörde beantragt werden kann. Eine bestimmte berufliche Qualifikation ist nicht erforderlich. Auf Antrag kann ein Auktionator auch öffentlich bestellt werden.
Fachliche Bestellungsvoraussetzungen für die öffentliche Bestellung und Vereidigung von Versteigerern:
Vorbildung des Versteigerers
Die öffentliche Bestellung setzt besondere Sachkunde des Versteigerers voraus. An diese Sachkunde einschlieÃÂlich Kenntnis der einschlägigen Rechtsvorschriften sind strenge Anforderungen zu stellen; eine mehrjährige Betätigung als Versteigerer oder Händler lässt für sich allein noch nicht auf besondere Sachkunde schlieÃÂen.
Für Versteigerer gibt es weder eine Ausbildungsordnung für eine berufliche oder gewerbliche Tätigkeit noch ein einschlägiges Berufsbild mit entsprechender Aus- und Vorbildung. Dies bedeutet, dass im Wesentlichen die praktische Tätigkeit als Versteigerer nach Erteilung der Erlaubnis gemäàç 34b Abs. 1 GewO dem Versteigerer die geeigneten Kenntnisse über die Breite der vorkommenden Geschäfte zu vermitteln hat.
Der erforderliche Nachweis der praktischen Tätigkeit wird dadurch erbracht, dass die Versteigerererlaubnis gemäàç 34b Abs. 1 GewO vorgelegt wird. Ebenso vorzulegen ist der Nachweis über die in den letzten fünf Jahren durchgeführten Versteigerungen. Eine Mindestzahl von Versteigerungsanzeigen gemäàç 5 VerstV wird nicht vorgeschrieben, es kommt auf den Schwierigkeitsgrad im Einzelfall und die nachhaltige Tätigkeit an.
Fachliche Kenntnisse
Die nach ç 4 VerstV herausgegebenen Verzeichnisse enthalten üblicherweise einen Schätzpreis. Es handelt sich hierbei um Wertangaben, die im Wege der Schätzung durch den Versteigerer ermittelt worden sind, soweit nicht ein Sachverständiger im Falle des ç 3 VerstV eine Schätzung vorgenommen hat.
Der Schätzpreis und der mit dem Auftraggeber vereinbarte Mindestpreis müssen in einem angemessenen Verhältnis zueinander stehen. Der Versteigerer muss daher in der Lage sein, die von Dritten genannten Preise aufgrund eigener Branchen- und Warenkunde zu beurteilen. Die Gewerbeordnung sieht auch die öffentliche Bestellung und Vereidigung für bestimmte Arten von Versteigerungen vor (ç 34b Abs. 5, 2. Alt. GewO). Beispielhaft seien hier Versteigerer für Industriemaschinen und Werkzeuge oder Briefmarken genannt. Das Maàder erforderlichen Sachkunde für eine öffentliche Bestellung richtet sich nach den einschlägigen fachlichen Bestellungsvoraussetzungen für Sachverständige auf dem betreffenden Sachgebiet.
Juristische Kenntnisse
Zahlreiche gesetzliche Vorschriften erwähnen die öffentliche Versteigerung bzw. den freihändigen Verkauf durch öffentlich bestellte und vereidigte Versteigerer. Eingehende Kenntnisse der gewerberechtlichen Vorschriften, insbesondere ç 34b GewO und der Versteigererverordnung sind unverzichtbar.
Nachzuweisen sind Grundkenntnisse derjenigen gesetzlichen Regelungen, die die öffentliche Versteigerung von beweglichen Sachen und Wertpapieren oder deren freihändigen Verkauf vorsehen. Insbesondere handelt es sich dabei um den Pfandverkauf (çç 1228 ff. BGB, ç 368, çç 397 ff., ç 410, ç 421, ç 440 HGB) und den Verkauf beweglicher Sachen nach den Vorschriften über den Pfandverkauf (çç 731, 753, 1003, 2022, 2042 BGB, ç 371 HGB) sowie um den Verkauf beweglicher Sachen aufgrund besonderer gesetzlicher Ermächtigungen (çç 383, 489, 966, 979, 1219 BGB, çç 373, 376, 379, 388, 391, 407, 417, 437 HGB) und den Verkauf aus freier Hand, wo dieser anstelle der gesetzlichen Versteigerung vorgesehen ist (z. B. ç 1221 BGB).
Auktionatoren in den USA
Auktionator in den USA beim typischen Singsang (auction chant)
In den USA gibt es private Auktionatorenschulen, die die praktischen und rechtlichen Grundlagen der Durchführung einer Auktion in Kursform lehren.[12] Eine weitere Besonderheit ist, dass Auktionatoren bei Auktionen permanent das aktuelle Gebot bzw. das zu erwartende nächsthöhere Gebot in schneller Folge und für unerfahrene Bieter aufgrund der bedeutungslosen Füllwörter (filler words), die die Melodie ausmachen, schwer verständlich wiederholen.[13] Der Sinn dieser MaÃÂnahme ist es, die Bieter zur rascheren Abgabe höherer Gebote zu animieren.[14] Auch diese sprachliche Tradition wird an Auktionatorenschulen gelehrt und erlernt, wobei jeder Auktionator später seinen eigenen Stil entwickelt. Diese im Englischen als auction chant (chant: âÂÂGesangâ oder âÂÂSingsangâÂÂ) bekannte Form der Aufrufe der Gebote ist auÃÂerhalb der USA, Kanadas und Südafrikas nicht verbreitet.[15][16]
Siehe auch
Gant (Recht)
GeiÃÂbockversteigerung
Selbsthilfeverkauf
Steigbrief
Zwangsversteigerung (Deutschland)
Literatur
Friederike Sophie Drinkuth: Der moderne Auktionshandel. Die Kunstwissenschaft und das Geschäft mit der Kunst. Böhlau Verlag, Köln 2003, ISBN 3-412-13702-2.
Hildegard Mannheims, Peter Oberem: Versteigerung. Zur Kulturgeschichte der Dinge aus zweiter Hand. Ein Forschungsbericht. (Beiträge zur Volkskultur in Nordwestdeutschland, Band 103). Waxmann, Münster u. a. 2003, ISBN 3-8309-1280-3.
Weblinks
Commons: Auktion â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikiquote: Auktion â Zitate
Wiktionary: Auktion â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Linkkatalog zum Thema Auktionen bei curlie.org (ehemals DMOZ)
Onlineauktionen und Recht zehnteiliger Beitrag zu Rechtsfragen von Rechtsanwalt Terhaag
Christiane Rossner: Eine kleine Kulturgeschichte der Auktionen. Monumente Online, Deutsche Stiftung Denkmalschutz.
Einzelnachweise
â Wiktionary: Lizitation â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen (englisch)
â So war es zum Beispiel bei einem Gemälde des englischen Malers William Turner, das auf einen Wert von 20 Millionen Euro geschätzt und in verschiedenen Filialen des Auktionshauses Sotheby’s gezeigt wurde: Letztes Mal Sotheby’s Köln stellt William Turners Ehrenbreitstein aus auf rundschau-online.de.
â Die üblen Tricks der eBay-Betrüger. Computerbild, 2. April 2008, abgerufen am 30. August 2013.
â Auctionata Paddle8 – Insolvenz Thomas Hesse auf gruenderszene.de.
â Vgl. Stille Auktion. (Memento vom 27. Januar 2012 im Internet Archive) annaberg-goes-wilde.de.
â Paul Milgrom: Putting Auction Theory to Work. Cambridge University Press, Cambridge 2005, ISBN 0-521-55184-6, S. 187.
â BGH, Urteil vom 7. November 2001, Az. VIII ZR 13/01, BGHZ 149, 129 = Volltext.
â OLG Frankfurt am Main, Urteil vom 1. März 2001, Az. 6 U 64/00, Volltext.
â BGH, Urteil vom 3. November 2004, Az. VIII ZR 375/03, Volltext, Rn. 10.
â BGH, Urteil vom 7. November 2001, Az. VIII ZR 13/01, Volltext.
â BGH, Urteil vom 3. November 2004, Az. VIII ZR 375/03, Volltext.
â ÃÂbersicht der Auktionatorenschulen im Verbund der National Auctioneers Association der USA, abgerufen am 23. März 2016.
â Daniel W. Patterson: Arts in Earnest. North Carolina Folklife. Duke University Press, Durham (North Carolina) 1989, ISBN 978-0-8223-1021-1, S. 106.
â Vorstellungsvideo von LearnToChant.com, abgerufen am 23. März 2016.
â Charles W. Smith: Auctions. The Social Construction of Value. University of California Press, Berkeley 1990, ISBN 978-0-520-07201-5, S. 116âÂÂ118.
â Charles W. Smith: Staging auctions: emabling exchange values to be contested and established. In: Brian Moeran, Jesper Strandgaard Pedersen (Hrsg.): Negotiating Values in the Creative Industries. Fairs, Festivals and Competitive Events. Cambridge University Press, Cambridge 2011, ISBN 978-1-107-00450-4, S. 94 ff., hier S. 100âÂÂ103.
Bitte den Hinweis zu Rechtsthemen beachten!
Normdaten (Sachbegriff): GND: 4125859-9 (OGND, AKS)
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Auktion&oldid=209598332#Internet-AuktionâÂÂ
Kategorien: AuktionVertragsrechtVersteckte Kategorie: Wikipedia:Belege fehlen
Navigationsmenü
Meine Werkzeuge
Nicht