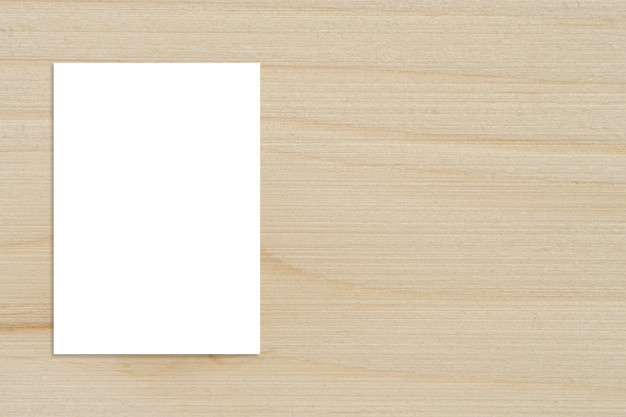Zur Suche springen
Der Titel dieses Artikels ist mehrdeutig. Weitere Bedeutungen sind unter Inn (Begriffsklärung) aufgeführt.
Inn
En / Sela
Verlauf und Einzugsgebiet des Inns
Daten
Gewässerkennzahl
CH: 44, AT: 2-8, DE: 18
Lage
Schweiz, ÃÂsterreich, Deutschland
Flusssystem
Donau
Abfluss über
Donau â Schwarzes Meer
Quelle
Oberhalb des Lunghinsees im Oberengadin
46ð 24â² 56â³ N, 9ð 40â² 0â³ O46.415439.666692564
Quellhöhe
2564 m ü. M.[1]
Mündung
In Passau in die Donau48.57282113.477406289Koordinaten: 48ð 34â² 22â³ N, 13ð 28â² 39â³ O
48ð 34â² 22â³ N, 13ð 28â² 39â³ O48.57282113.477406289
Mündungshöhe
289 m ü. NHN[2]
Höhenunterschied
2275 m
Sohlgefälle
4,4 â°
Länge
517 km[3]
Einzugsgebiet
26.130 kmò[3]
Abfluss am Pegel Martina (Schweizer Grenze)[4]
AEo: 1941 kmò
NNQ (2004)
MNQ 1970âÂÂ2016
MQ 1970âÂÂ2016
Mq 1970âÂÂ2016
MHQ 1970âÂÂ2016
HHQ (1987)
2,37 mó/s
37,7 mó/s
53,3 mó/s
27,5 l/(s kmò)
81,3 mó/s
481 mó/s
Abfluss am Pegel Innsbruck[5]
AEo: 5.631,5 kmò
Lage: 298,51 km oberhalb der Mündung
NNQ (31. Jan. 1962)
MNQ 1971âÂÂ2009
MQ 1971âÂÂ2009
Mq 1971âÂÂ2009
MHQ 1971âÂÂ2009
HHQ (23. Aug. 2005)
18,8 mó/s
40,1 mó/s
163 mó/s
28,9 l/(s kmò)
718 mó/s
1525 mó/s
Abfluss am Pegel Wasserburg[6]
AEo: 11.980 kmò
Lage: 158,7 km oberhalb der Mündung
NNQ (28. Dez. 1969)
MNQ 1965/2006
MQ 1965/2006
Mq 1965/2006
MHQ 1965/2006
HHQ (23. Aug. 2005)
93,8 mó/s
131 mó/s
358 mó/s
29,9 l/(s kmò)
1450 mó/s
2940 mó/s
Abfluss am Pegel Passau Ingling[7]
AEo: 26.063 kmò
Lage: 3,1 km oberhalb der Mündung
NNQ (2. Nov. 1947)
MNQ 1921/2006
MQ 1921/2006
Mq 1921/2006
MHQ 1921/2006
HHQ (10. Jul. 1954)
195 mó/s
283 mó/s
740 mó/s
28,4 l/(s kmò)
2960 mó/s
6700 mó/s
Linke Nebenflüsse
Sanna, Brandenberger Ache, Mangfall, Attel, Isen, Rott
Rechte Nebenflüsse
ÃÂtztaler Ache, Melach, Sill, Ziller, Murn, Alz, Salzach
GroÃÂstädte
Innsbruck
Mittelstädte
Rosenheim, Passau
Kleinstädte
Landeck, Imst, Telfs, Hall in Tirol, Schwaz, Rattenberg, Wörgl, Kufstein, Wasserburg, Mühldorf, Töging, Altötting, Neuötting, Simbach, Braunau, Schärding
Schiffbar
Nicht schiffbar, örtlich Fahrgastschifffahrt
Der Inn zwischen Wernstein und Passau
Der Inn (rätoromanisch En?/i, lat. Aenus, auch Oenus,[8] altgriechisch ÃÂἶýÿÃÂ[9]) ist ein 517 km langer, durch die Schweiz, ÃÂsterreich und Deutschland verlaufender rechter Nebenfluss der Donau. An der Mündung in Passau flieÃÂen im Mittel 738 mó/s Wasser in die nur 690 mó/s heranführende Donau.[10] Der gröÃÂere Mittelwert des Inns beruht auf den Hochwässern des Gebirgsflusses. Während sieben Monaten führt der Inn am Zusammenfluss in Passau weniger Wasser als die Donau.
Inhaltsverzeichnis
1 Etymologie
2 Geografie
2.1 Länge und Einzugsgebiet
2.2 Hydrologie
2.3 Flusslauf
2.4 Wichtige Orte am Inn
2.5 Geologie
2.6 Nebenflüsse
3 ÃÂkologie
3.1 Flora
3.2 Fauna
3.3 Wasserqualität
4 Nutzung
4.1 Schifffahrt
4.2 StraÃÂenverkehr
4.3 Fischerei
4.4 Elektrizitätswerke
4.5 Freizeit
4.6 Gewinnung von Inngold
5 Galerie
6 Siehe auch
7 Literatur
8 Weblinks
9 Einzelnachweise
Etymologie
Der Ursprung des Inns (Urpsrung des Ã
¸ns / Fons Oeni) am Julierpass; Detail der Tirol-Karte des Warmund Ygl (1605)
Der Name Inn leitet sich von den keltischen Wörtern en sowie enios ab, die frei übersetzt Wasser bedeuten. In einer Urkunde des Jahres 1338 ist der Fluss mit dem Namen Wasser eingetragen. Die erste schriftliche Erwähnung stammt aus den Jahren 105 bis 109 von Tacitus. Sie lautet:[11]
âÂÂ[â¦] Sextilius Felix [â¦] ad occupandam ripam Aeni fluminis, quod Raetos Noricosque interfluit, missus.âÂÂ
âÂÂ[â¦] wurde Sextilius Felix [â¦] zum Einnehmen des Ufers des Flusses Inn, der zwischen Rätern und Norikern flieÃÂt, geschickt.âÂÂ
â Tacitus: Publii Corneli Taciti historiarium liber tertius
Von späteren Autoren der römischen Kaiserzeit wird der Flussname ähnlich verschriftlicht, etwa als griechisch ÃÂἶýÿà(Aïnos) oder lateinisch Aenus. Im mittelalterlichen Latein wird er zumeist Enus geschrieben, von den Humanisten Oenus. Durch den Lautwandel im Altbairischen von e zu i wird aus Enus In. Bis ins 17. Jahrhundert wird es so oder Yn geschrieben, aber auch Ihn oder Yhn. Das Doppel-n taucht erst im 16. Jahrhundert auf, etwa im Tiroler Landreim von 1557. Seit dem 18. Jahrhundert ist diese Schreibweise und die Aussprache mit kurzem Vokal üblich. Früher wurde die Bezeichnung meist als Neutrum betrachtet (daz In heiÃÂt es beispielsweise im Nibelungenlied), seit dem 16. Jahrhundert ausschlieÃÂlich als Maskulinum.[12]
Die Erwähnungen in der Römerzeit beziehen sich auf den Unterlauf, der Tiroler Abschnitt wird erstmals bei Venantius Fortunatus im 6. Jahrhundert als Aenus bezeichnet. Der Name Engadin und die rätoromanische Bezeichnung En deuten darauf hin, dass auch der Oberlauf seit jeher so bezeichnet wurde. Auch wenn vereinzelt die Auffassung vertreten wurde, dass der Inn in der Nähe der Etsch am Reschen entspringt, wird spätestens seit dem 16. Jahrhundert der Ursprung einheitlich im Bereich der Seen am Malojapass gesehen.[12]
Möglicherweise besteht ein Zusammenhang zwischen dem Namen Inn und dem des französischen Flusses Ain.[13]
Geografie
Länge und Einzugsgebiet
Mit einer Gesamtlänge von 517 Kilometern ist der Inn einer der längsten und mächtigsten Alpenflüsse. Nahezu zwei Drittel seines Flusslaufes liegen im Gebiet der Alpen. 193 km flieÃÂt der Inn durch ÃÂsterreich.
Das Einzugsgebiet des Inns beträgt 26.130 kmò[3] (nach anderen Angaben 26.053 kmò[14]). Davon liegen 1689 kmò im Kanton Graubünden, 254 kmò (am Oberlauf des Spöl und des Stillebachs) in Italien, 7880 kmò in Tirol,[3]
8061 kmò in Bayern[14] und rund 8250 kmò in Salzburg und Oberösterreich.
Im Einzugsgebiet des Inns befinden sich 823 Gletscher, die zusammen 395 kmò oder 1,5 % der Fläche einnehmen.[3]
Der höchste Punkt im Einzugsgebiet ist der Piz Bernina mit 4049 m ü. M.
Hydrologie
Mit einer mittleren Wassermenge von 738 Kubikmetern pro Sekunde ist der Inn, nach dem Rhein, der Donau und der Elbe (wenn die Nebenflüsse des ÃÂstuars dazugerechnet werden), der viertwasserreichste Fluss Deutschlands sowie der zweitwasserreichste ÃÂsterreichs. Er führt der Donau mehr Wasser zu als Lech, Isar, Enns und Traun zusammen. Obwohl die Elbe fünfmal so viel Stromgebiet entwässert, ist sie nur unwesentlich wasserreicher, da in den Alpen die Niederschlagsmengen und Abflussraten höher sind.
Das Abflussregime des Inns ist aufgrund der alpinen Schneeschmelze und der gröÃÂeren mittleren Hangneigung in seinem Einzugsgebiet unausgeglichener als das der Donau. Insbesondere im Oberlauf ist das Abflussregime stark durch die Vergletscherung am Alpenhauptkamm (Zentralbereiche der ÃÂtztaler, Stubaier, Zillertaler Alpen und Hohen Tauern) beeinflusst. Am Pegel Innsbruck weist der Inn ein nivo-glaziales Abflussregime mit einem Anteil von 10 % Gletscherwasser auf, das nur im Zeitraum von Mai bis Oktober anfällt und im Juli und August mit 25 % den höchsten Anteil am Abfluss erreicht.[15]
Mittlere monatliche Abflüsse des Inns (in mó/s) am Pegel Passau-Ingling
Reihe 1920/2005[7]
Der mittlere Abfluss des Inns in Passau ist zwar rund 7 % gröÃÂer als der der Donau, der Inn führt aber die meiste Zeit des Jahres (vom Frühherbst bis zum Frühling) weniger Wasser. Auch wenn visueller Eindruck und Gesamtwasserführung nahelegen, von der Mündung der Donau in den Inn zu sprechen, ist der Name Donau für den vereinigten Strom zu rechtfertigen; denn die Donau ist hier mit 547 km länger als der Inn mit 517 km und die Donau behält, anders als der Inn, ihre FlieÃÂrichtung unverändert bei.
Flusslauf
Europäische Wasserscheide
Der Fluss entspringt nordöstlich vom Pass Lunghin im Schweizer Oberengadin in 2564 m Höhe oberhalb des Lunghinsees. Der Pass oberhalb des Ursprungs ist ein europäischer Hauptwasserscheidepunkt (Nordsee, Schwarzes Meer, Adria).
Inn im Unterengadin zwischen Susch und Lavin (2008)
Bis zum Zusammenfluss mit dem gröÃÂeren Flaz wird der Inn (En) auch Sela genannt und durchflieÃÂt zunächst den Silser-, den Silvaplaner-, den Champfèrer- und den St. Moritzersee. Der kleine Lej da Gravatscha nahe der Mündung des Flaz ist ein wichtiges Brutgebiet für Vögel. Im Unterengadin durchflieÃÂt der Inn mit deutlich stärkerem Gefälle mehrere Schluchten.
Unterhalb der schweizerisch-österreichischen Grenze am Engpass von Finstermünz wird sein Tal im Bundesland Tirol Oberinntal genannt und unterhalb der Einmündung der Melach bei Zirl Unterinntal. Zwischen Kufstein und Erl verläuft die österreichisch-deutsche Staatsgrenze in Flussmitte. Danach durchquert der Inn die südöstliche Ecke Bayerns; ab der Mündung der Salzach bis zur Stadtgrenze von Passau markiert er wieder die deutsch-österreichische Grenze. Am unteren Inn stehen mehrere groÃÂe Stauwerke. Hier erstreckt sich auch über eine Länge von 55 Kilometern das Europareservat Unterer Inn. Der Inn zwischen Braunau und Schärding ist Namensgeber für das angrenzende oberösterreichische Innviertel (politische Bezirke Braunau, Schärding, Ried im Innkreis).
Mündung des Inns (im Bild links) in die Donau in Passau
Der Inn mündet in der âÂÂDreiflüssestadtâ Passau in die Donau. Noch ein längeres Stück nach dem Zusammenfluss bleiben das grüne Gletscherschmelzwasser des Inns, das blaue Donauwasser und das dunkle Moorwasser der von Norden mündenden Ilz in der Donau unvermischt unterscheidbar. Die 2,34 km unterhalb der Innmündung nahe dem rechten Ufer liegende Felseninsel Kräutelstein ist noch vom unvermischten Innwasser umspült. Auffallend ist, wie stark das grüne Wasser des Inns das Wasser der Donau beiseite drängt. Dies hängt mit der zeitweise sehr groÃÂen Wassermenge des Inns und den unterschiedlichen Tiefen der beiden Gewässer zusammen (Inn: 1,90 Meter, Donau: 6,80 Meter) â âÂÂder Inn überströmt die DonauâÂÂ.
Wichtige Orte am Inn
Schweiz: St. Moritz, Samedan, Scuol
ÃÂsterreich: Landeck, Imst, Telfs, Zirl, Völs, Innsbruck, Hall in Tirol, Wattens, Schwaz, Jenbach, Brixlegg, Rattenberg, Kundl, Wörgl, Kufstein, es folgt der Durchfluss durch Bayern, ab hier Grenzfluss, Braunau am Inn, Obernberg am Inn, Schärding
Deutschland: Rosenheim, Wasserburg am Inn, Mühldorf am Inn, Neuötting, Marktl, ab hier Grenzfluss, Simbach am Inn, Passau
Geologie
Bis Landeck verläuft der Inn in den Zentralalpen, wobei er hauptsächlich Kristallingebiete berührt und bei Ardez in das Engadiner Fenster mit seinen Bündnerschiefern eintritt. Von Flieàbis Landeck durchbricht er den Landecker Quarzphyllit. Ab Landeck bildet das Inntal als groÃÂes Alpenlängstal die Grenze zwischen den Nördlichen Kalkalpen und den Zentralalpen. Zwischen Schwaz und Brixlegg durchflieÃÂt der Inn die Grauwackenzone und anschlieÃÂend die Nördlichen Kalkalpen. Bei Erl erreicht er das Alpenvorland und durchquert in Bayern die eiszeitlich überformte Flysch- und Molassezone, die von Moränenresten, diluvialen Schotterkörpern und Terrassen geprägt ist. Bei Schärding tritt er in die Böhmische Masse ein.[16][3] Während der Kaltzeiten war das Tal im Ober- und Mittellauf von Gletschereis angefüllt. Untersuchungen an Torfablagerungen des Lanser Sees bei Innsbruck belegen, dass das Tal spätestens ab 15.379 ñ 282 Jahre v. Chr. eisfrei gewesen sein muss.[17] Der Rödschitz-Torf verlagert das Alter der Enteisung sogar noch weiter zurück in die Zeit 16.668 ñ 503 v. Chr. im Gebiet des Traungletschers.[18]
Nebenflüsse
Mündung der Mangfall (vorne) bei Rosenheim
Mündung der Salzach (von links) in den Inn
Die folgende Tabelle enthält alle Zuflüsse mit einem Einzugsgebiet von mehr als 500 kmò oder einem mittleren Abfluss (MQ) von mehr als 10 mó/s. Eine umfassende Auflistung findet sich unter Liste von Zuflüssen des Inns.
Zufluss
Seite
Länge +
in km
Einzugsgebiet
in kmò
MQ ÃÂ
in mó/s
Spöl
rechts
028,0
0310
010,8
Sanna
links
053,2
0728
020,0
ÃÂtztaler Ache
rechts
066,5
0894
031,3
Sill
rechts
042,2
0855
024,5
Ziller
rechts
055,7
1135
044,5
Brandenberger Ache
links
033,1
0282
010,4
Brixentaler Ache
rechts
028,0
0330
010,9
Mangfall
links
058,0
1099
026,9
Isen
links
076,0
0586
005,6
Alz
rechts
150,0
2239
068,5
Salzach
rechts
225,0
6700
252,0
Rott
links
111,4
1200
009,3
+ mit längstem Quellfluss des Zuflusses
àmittlerer Abfluss am mündungsnächsten Pegel des Zuflusses
ÃÂkologie
Unterer Inn bei Aigen am Inn
Der Inn ist heute über weite Strecken begradigt und verbaut, seine FlieÃÂstrecke ist durch zahlreiche Kraftwerke beeinträchtigt; eine längere freie FlieÃÂstrecke von 150 km besteht noch zwischen Flieàund Kirchbichl. Vereinzelt finden sich noch naturnähere Abschnitte und Reste der ursprünglichen Auwälder, die oft als Natur- oder Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen sind. Am unteren Inn im bayrisch-oberösterreichischen Grenzgebiet hat sich der Charakter des Inns infolge der Kraftwerksbauten grundlegend vom alpinen zum Tieflandfluss mit groÃÂen, offenen Wasserflächen gewandelt. Neben diesen Wasserflächen entstanden Anlandungen und weitläufige Aubereiche, die ein international bedeutendes Brut-, Rast- und ÃÂberwinterungsgebiet für rund 300 Vogelarten darstellen.[19]
Die Au- und Wasserflächen am unteren Inn sind unter anderem als Europaschutzgebiet ausgewiesen.
Flora
Deutsche Tamariske auf einer Schotterbank bei Pfunds
Innerhalb der Hochwasserschutzdämme am unteren Inn finden sich Silberweidenauen, die Auwälder auÃÂerhalb bestehen hauptsächlich aus Eschen und Grauerlen, in trockeneren Bereichen auch aus Bergahornen.[19]
Die früher weit verbreitete Deutsche Tamariske ist durch Verbauungen fast ausgerottet worden, einzelne Bestände finden sich in den Mieminger und Rietzer Innauen, im Oberen Gericht sowie im Engadin.[20][21]
An den Stauseen am unteren Inn finden sich als gefährdete Pflanzenarten Tannenwedel und Schwanenblume.[22]
Fauna
Vom Ursprung bis Landeck zählt der Inn zur Forellenregion, unterhalb zur ÃÂschenregion, im Unterlauf besteht ein ÃÂbergang von der Barben- zur Brachsenregion. Im Tiroler Inn konnten von ursprünglich 31 Fischarten nurmehr 17 nachgewiesen werden. Zu den Arten, die im gesamten Tiroler Verlauf vorkommen, gehören Bachforelle, Regenbogenforelle und ÃÂsche, als gefährdet gelten Huchen, Strömer und Aalrutte.[23]
Im unteren Inn hat sich durch den Kraftwerksbau die Fischfauna verändert. Neben den früher typischen Arten Barbe, Nase und Huchen haben sich Fischarten, die ruhigere Flussabschnitte oder stehende Gewässer bevorzugen, angesiedelt, darunter Brachse, Karpfen, Hecht, Rotfeder und Rotauge.[19]
Der Europäische Biber wurde in den 1970er Jahren auf der bayerischen Seite der Innstauseen wieder angesiedelt und hat sich seither ausgebreitet. Zwischen der Salzachmündung und der Antiesenmündung finden sich rund 15 Reviere[19], der Biber ist aber auch flussaufwärts bis ins Tiroler Oberinntal gewandert.[24] Allmählich siedelt sich am unteren Inn auch der Fischotter wieder an.[25]
Die Auen dienen zahlreichen, darunter etlichen gefährdeten, Vogelarten als Lebens- und Brutraum. Bedeutsam sind u. a. Brutvorkommen von FluÃÂuferläufer, Nachtigall und Gartenbaumläufer in der Silzer Innau[26], vom Flussregenpfeifer in der Innschleife bei Kirchbichl[27], oder von Zwergdommel, Nachtreiher, Seidenreiher, Rohrweihe, Schwarzmilan, Schwarzkopfmöwe, Flussseeschwalbe, Eisvogel, Blaukehlchen, Brandgans, WeiÃÂkopfmöwe und Lachmöwe am unteren Inn.[19]
Wasserqualität
Der Inn weist in Tirol, Bayern und Oberösterreich im gesamten Verlauf Gewässergüteklasse II (mäÃÂig verunreinigt) auf, mit Ausnahme des Tiroler Abschnittes von der Einmündung der Sanna bis zur Einmündung der Pitze, wo er Klasse IâÂÂII erreicht.[28][29]
Nutzung
Schifffahrt
Personenschifffahrt auf dem Inn
Legende
Schaurecker
Ingling
Wernstein
Schaurecker
Schärding
Held
Wasserburg
ehem. Innschifffahrt
Tirol-Bayern (bis 2011)
Oberaudorf
Niederndorf
Ebbs
Kiefersfelden
Kufstein
Fahrgastschiff St. Nikolaus (2000âÂÂ2011, hier: 2010) in Kufstein
Schifffahrt auf dem Inn gab es schon zur Zeit der Römer. Im Jahr 1190 gewährte Kaiser Heinrich IV. die Einrichtung einer Salzstapelniederlassung in Mühldorf am Inn. Es folgten weitere Innstädte mit verschiedenen Rechten zum Handel auf dem Inn. Oberer Endpunkt der Innschifffahrt war Hall, das dadurch der wichtigste Warenumschlagplatz Nordtirols war und u. a. das Stapelrecht für Getreide besaÃÂ. Weiter hinauf bis Mötz konnte der Inn noch mit FlöÃÂen (überwiegend flussabwärts) befahren werden.[30] Neben dem Salz aus Tirol wurden besonders Eisenerz, Silber, Kupfer, Kalk, Holz, Tuche und Tiroler Wein in Schiffszügen flussabwärts bis Wien geschifft. Aus dem Engadin wurde Holz nach Innsbruck, zur Salzpfanne nach Hall und zum Teil bis nach Rosenheim geflöÃÂt.[31] Wasserburg am Inn war die bedeutendste Stadt der Innschifferei. Dort und in den anderen Städten brachten es die Schiffsmeisterfamilien zu erheblichem Wohlstand.
Für die Fahrt flussabwärts wurden meist einfache, flache Plätten gezimmert, die am Zielort als Bau- oder Nutzholz verkauft werden konnten. Bei der Rückfahrt transportierte man besonders Weizen, Fleisch, Fett und österreichischen Wein. Dabei wurden die Schiffe unter Führung eines Stangenreiters von einem Pferdevorspann auf dem Treidelweg stromaufwärts gezogen. Sechs bis zwanzig hintereinander gespannte Pferde zogen die Schiffe, so konnten auf einem Leitschiff mit zwei bis drei Lastschiffen bis zu 100 Tonnen Getreide flussaufwärts transportiert werden. Die Fahrt von Hall nach Kufstein dauerte rund fünf Stunden, nach Wien knapp eine Woche. Flussaufwärts brauchte das Ziehen eines Lastzugs von Kufstein nach Hall vier bis fünf Tage.[32]
Neben Gütern wurden auf dem Inn auch Personen befördert. Insbesondere für das Militär war der Fluss ein bedeutender und sicherer Nachschubweg. So wurden 1532 in Hall 20.000 Italiener und Spanier auf 45 Schiffen nach Wien verschifft, wo sie das Heer Kaiser Karls V. gegen die Türken verstärken sollten. 1765 wurde der Leichnam des in Innsbruck verstorbenen Kaisers Franz I. Stephan auf einem Schiff von Hall nach Wien transportiert, gefolgt von 19 Schiffen mit seiner Gattin Maria Theresia und ihrem Hofstaat.[30]
Mit der Eröffnung der Unterinntalbahn von Kufstein nach Innsbruck im Jahre 1858 kam das Ende für die Innschifffahrt in Tirol. Mit dem Bau von Staustufen mit Wasserkraftwerken, die nicht über Schleusen verfügten, wurde eine durchgehende Schifffahrt unmöglich. Nur örtlich, beispielsweise zwischen Neuhaus am Inn/Schärding und Passau sowie in Wasserburg am Inn findet auf dem Inn Fahrgastschifffahrt statt.
Von Kufstein bis Niederndorf gab es ab 1998, anfangs mit dem kleineren Motorschiff Tirol, ab April 2000 mit dem zweischraubigen 85-t-116-Personen-Schiff St. Nikolaus bis 2011 eine touristisch orientierte Innschifffahrt. Eingestellt wurde sie auch, weil Hochwässer mitunter den Betrieb verhinderten, mangels ausreichender Fahrgastzahlen; das Schiff St. Nikolaus wurde im April 2013 nach Hamburg verkauft.[33][34][35]
StraÃÂenverkehr
Inntalautobahn, Arlbergbahn und Inn östlich von Landeck
Der Inn ist zwar nicht in ganzer Länge seines Alpentals eine günstige natürliche Leitlinie für den Verkehr, zum einen wegen mehrerer Engpässe, zum anderen wegen der für den Alpenquerverkehr ungünstigen Längstalrichtung; seine Breite und relative Klimagunst machen das Inntal trotzdem zu einem früh besiedelten eigenen Wirtschaftsraum. Da es am breiten und stark strömenden Inn früher nur wenige Brücken gab, verlangte man seit dem Mittelalter für Bau und Erhalt Brückenzoll, meist von Fuhrwerken, etwa in Zams.
Heute verlaufen die Bundesautobahn 93 und die Inntalautobahn A 12 sowie die Unterinntalbahn und die Arlbergbahn im Inntal. Die Verteilerfunktion zu niedrigen Alpenpässen wie Reschenpass und Brennerpass ist einerseits der Wirtschaft förderlich, belastet das Tal aber zunehmend mit Umweltfolgen des Individualverkehrs. So werden die EU-Grenzwerte für die Luftreinhaltung im Unterinntal oft erheblich überschritten.[36]
Derzeit ist die Neue Unterinntalbahn als Zulaufstrecke des Brennerbasistunnels in Bau.
Fischerei
In der Vergangenheit spielte die Fischerei am Inn eine groÃÂe wirtschaftliche Rolle. So wurden Fische aus dem Inn und den Oberengadiner Seen bis ins 19. Jahrhundert nach Italien verkauft.[31]
Die Fischerei nahm bisweilen überhand, sodass bereits um 1553 im Rahmen der Bayerischen Landordnung 1553 eine Fischordnung für das Herzogtum Bayern erlassen und im selben Jahr von den Brüdern Alexander und Samuel WeiÃÂenhorn in Ingolstadt mit hochwertigen Holzschnitten versehen gedruckt[37] wurde, da der Fischbestand fast âÂÂverödigtâ war. Dabei wurden erstmals Fangbeschränkungen und MindestmaÃÂe (z. B. âÂÂPrüttelmaÃÂâÂÂ, âÂÂPrüttl-MaÃÂâ oder âÂÂBrütelmaÃÂâ mit 10 cm oder âÂÂKarpffen-MaÃÂâ mit 26,4 cm) eingeführt. AuÃÂerdem wurde der Betrieb von âÂÂArchenâ (auch âÂÂFacheâ genannt[38]), reusenartigen Einbauten im Fluss, untersagt, die nicht nur die Fischbestände dezimierten, sondern auch Hindernisse für die Schifffahrt darstellten. Heute hat die Fischerei keine kommerzielle Bedeutung mehr.[19]
Elektrizitätswerke
Wehr Runserau des Kraftwerks Imst
Am Oberlauf des Inns vom Schweizer Gebiet bis ins österreichische Landeck in Tirol befinden sich mehrere Wasserkraftwerke. Staustufen im Unterlauf ab Kufstein dienen sowohl der Energiegewinnung als auch dem Hochwasserschutz. Da diese Kraftwerke nicht über Schleusen verfügen, wird die Schiffbarkeit des Inns durch diese Kraftwerke stark eingeschränkt.
Das älteste Tiroler Kraftwerk ist in Kirchbichl, nach über 70 Jahren wird die bestehende Wehranlage für Extremereignisse erweitert und zur bestehenden Wehranlage eine zusätzliche Abflussmöglichkeit geschaffen. Dafür ist der Ausbau des rund einen Kilometer langen Triebwasserweges geplant. Dadurch und durch den Bau einer Hochwasserentlastung kann das Krafthaus um eine Turbine erweitert werden, die Regeljahreserzeugung wird von derzeit 131 GWh um etwa 45 GWh steigen.[39]
Das Kraftwerk Imst nutzt eine für ein Laufkraftwerk ungewöhnlich groÃÂe Fallhöhe von 143,5 m, indem der Inn in der Runserau bei Flieàaufgestaut und das Wasser durch einen 12,3 km langen Druckstollen quer durch das Venetmassiv in die Imsterau geleitet wird, wodurch es das Innknie bei Landeck abschneidet.[40]
Wasserkraftwerke am Inn (Reihenfolge flussaufwärts)
Stat.+
[km]
Ort
Nennleistung
in MW
erbaut
(betrieben seit)
Durchfluss
in mó/s
Fallhöhe
in m
Turbinen
Anzahl
Betreiber
Bemerkung
~004
Passau-Ingling
086,00
1962 (1965)/
285,0
010,4
4
Grenzkraftwerke
~019
Schärding-Neuhaus
096,00
1961 (1963)/
287,5
011,2
4
Grenzkraftwerke
~035
Egglfing-Obernberg
080,70
1944 (0000)/
186,0
010,1
6
VERBUND Hydro Power AG
~048
Ering-Frauenstein
072,90
1942 (0000)/
352,0
009,1
4
VERBUND Hydro Power AG
~061
Braunau-Simbach
100,00
1953 (0000)/
287,5
012,1
4
Grenzkraftwerke
~075
Stammham
023,20
1955 (0000)/
185,0
005,7
3
VERBUND Hydro Power AG
~083
Perach
019,40
1977 (0000)/
170,0
005,2
3
VERBUND Hydro Power AG
~091
Neuötting
026,10
1951 (0000)/
196,0
006,7
4
VERBUND Hydro Power AG
~100
Töging
085,30
1924 (0000)/
340,0
030
14
VERBUND Hydro Power AG
am Innkanal
~128
Jettenbach 1
000,40
1994 (0000)/
005,0
008,4
1
VERBUND Hydro Power AG
~128
Jettenbach 2
005,00
1994 (0000)/
037,5
008,4
2
VERBUND Hydro Power AG
~137
Gars am Inn
025,00
1938 (0000)/
090,0
007,2
5
VERBUND Hydro Power AG
~147
Teufelsbruck
025,00
1938 (0000)/
090,0
007,0
5
VERBUND Hydro Power AG
~160
Wasserburg
024,10
1938 (0000)/
095,0
007,0
5
VERBUND Hydro Power AG
~173
Feldkirchen
038,20
1970 (0000)/
178,0
008,7
3
VERBUND Hydro Power AG
~188
Rosenheim
035,10
1960 (0000)/
215,0
008,3
3
VERBUND Hydro Power AG
~199
NuÃÂdorf
047,90
1982 (0000)/
550[41]
011,7
2
Innwerk AG
~211
Oberaudorf-Ebbs
059,00
1992 (0000)/
580[42]
012,4
2
Grenzkraftwerke
~223
Langkampfen[43]
031,50
1998 (0000)/
425,0
008,3
2
TIWAG
~233
Kirchbichl[44]
023,00
1941 (0000)/
250,0
009,7
3
TIWAG
Ausleitkraftwerk
~383
Imst[40]
089,00
1956 (0000)/
085,3
143,5
TIWAG
Ausleitkraftwerk
~425
Scuol
288,00
1970/1994 ()
72[45]
Engadiner Kraftwerke
Ausleitkraftwerk
~466
S-chanf/Ova-Spin
050,00
1970 (0000)/
29[42]
Engadiner Kraftwerke
Ausleitkraftwerk
~486
St. Moritz
004,36
1932 (0000)/
E-Werke St. Moritz
+ Stationierung oder Kilometrierung, das ist die Strecke innaufwärts gemessen von der Innmündung bis zum jeweiligen Kraftwerk.
Freizeit
Wildwasserpaddler auf dem Inn bei Haiming
Der Inn bietet im Oberlauf vielfältige Möglichkeiten für den Wassersport, vor allem für Wildwasserpaddeln und Rafting, auf den Oberengadiner Seen (Silsersee, Silvaplanersee und St. Moritzersee) u. a. für Wind- und Kitesurfen. Ein beliebter Abschnitt bei Wildwassersportlern ist die 5 km lange Imster Schlucht, deren Schwierigkeitsgrad abhängig vom Wasserstand zwischen WW II-III und III-IV liegt.[46]
Entlang der Hochwasserdämme führen auf weiten, zusammenhängenden Strecken Radwege. Der Inn-Radweg folgt dem Flusslauf von Maloja bis zur Mündung. Entlang des Inn liegen viele Baggerseen, die durch Kiesgewinnung entstanden sind. ÃÂrtlich verkehren linienmäÃÂig Personenschiffe. Das Inn-Museum in Rosenheim dokumentiert die Geschichte des Inns und der Innschifffahrt.
Gewinnung von Inngold
Eine Besonderheit aus der Geschichte der Nutzung war die Gewinnung von Gold aus dem Sand des Inns zur Prägung von Flussgolddukaten. Sie sind durch die Umschrift EX AURO OENI (= aus dem Gold des Inns) erkennbar.[47]
Galerie
Innbrücke bei Silvaplana
Der junge Inn bei Bever im Engadin
Der Inn bei Susch im Unterengadin
Der Inn in Ried im Oberinntal
Der Inn bei Brixlegg
Baggerschiff im Stausee bei Langkampfen
Der Inn bei Kufstein
Der Inn bei Wasserburg
Der Inn bei Mühldorf am Inn
Der Inn bei Schloss Neuhaus
Der Inn und die Marienbrücke in Passau
Siehe auch
Inn-Salzach-Bauweise
Literatur
Franz Hafner: Inn â Der grüne Fluss aus den Alpen. Filmdokumentation, ÃÂsterreich, 2011. 45 Min. Senderinformation mit vielen Bildern, Mediathek.
A. Stancik, H. Schiller, O. Behr et al.: Hydrology of the River Danube / Hydrologie der Donau. Gemeinsames Forschungsprojekt der Donauländer und der IHD, 272 S., Verlag Priroda, Bratislava 1988.
Valentin Weber-Wille, Manfred Wehdorn: Architektur bei VERBUND. Die bayerischen Innkraftwerke, Band 105 der Schriftenreihe Forschung in der VERBUND AG, Selbstverlag, Wien 2012, ISBN 3-9502188-6-6.
Josef Grünberger: Land am Inn â Vom Ursprung zur Mündung. Tyrolia Verlag 2004, ISBN 3-7022-2586-2.
Weblinks
Commons: Inn â Sammlung von Bildern, Videos und Audiodateien
Wikivoyage: Inn â Reiseführer
Wiktionary: Inn â Bedeutungserklärungen, Wortherkunft, Synonyme, ÃÂbersetzungen
Inn auf der Plattform ETHorama
Einzelnachweise
â Geoserver der Schweizer Bundesverwaltung (Hinweise)
â Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Donaugebiet 2006 Bayerisches Landesamt für Umwelt, S. 302, abgerufen am 4. Oktober 2017, Auf: bestellen.bayern.de (PDF, deutsch, 24,2 MB).
â a b c d e f Land Tirol/Lebensministerium ÃÂsterreich: Der Inn und sein Einzugsgebiet (PDF; 3,7 MB)
â Messstation Martina 1970âÂÂ2016 (PDF) Bundesamt für Umwelt BAFU
â Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Hrsg.): Hydrographisches Jahrbuch von ÃÂsterreich 2009. 117. Band. Wien 2011, S. OG 99, PDF (12,1 MB) auf bmlrt.gv.at (Jahrbuch 2009)
â Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Donaugebiet 2006 Bayerisches Landesamt für Umwelt, S. 225, abgerufen am 4. Oktober 2017, Auf: bestellen.bayern.de (PDF, deutsch, 24,2 MB).
â a b Deutsches Gewässerkundliches Jahrbuch Donaugebiet 2006 Bayerisches Landesamt für Umwelt, S. 227, abgerufen am 4. Oktober 2017, Auf: bestellen.bayern.de (PDF, deutsch, 24,2 MB).
â Itinerarium Antonini
â Claudius Ptolemaeus 2.11.5
â Wasserführung der Donau an der Inn-Mündung@1@2Vorlage:Toter Link/www.uvm.baden-wuerttemberg.de (Seite nicht mehr abrufbar, Suche in Webarchiven) im Profil des Donau-Wasservolumens (Zusammenarbeit und Umsetzung der EU-WRRL im Einzugsgebiet der Donau, Informationsveranstaltung Wasserwirtschaftliche Zusammenarbeit und Zielsetzungen im EZ-Gebiet der Donau, Sigmaringen, 25. Januar 2006)
â Wolf-Armin Frhr. v. Reitzenstein: Lexikon bayerischer Ortsnamen. Herkunft und Bedeutung. C.H.Beck, München 2006, ISBN 3-406-55206-4, S. 123.
â a b Otto Stolz: Geschichtskunde der Gewässer Tirols. Schlern-Schriften, Band 32, Innsbruck 1932, S. 6âÂÂ14 und 83âÂÂ88 (Digitalisat)
â Arnaud Vendryes: L’Ain : le nom d’une rivière àtravers les sources. In: Société d’Emulation du Jura, Travaux 2015, S. 147âÂÂ168
â a b Verzeichnis der Bach- und Flussgebiete in Bayern â Flussgebiet Inn, Seite 1 des Bayerischen Landesamtes für Umwelt, Stand 2016 (PDF; 2,8 MB)
â Markus Weber, Ludwig Braun, Wolfram Mauser, Monika Prasch: Die Bedeutung der Gletscherschmelze für den Abfluss der Donau gegenwärtig und in der Zukunft. In: Mitteilungsblatt des Hydrographischen Dienstes in ÃÂsterreich, Nr. 86 (2009), S. 1âÂÂ30 (PDF; 6,1 MB (Memento vom 12. November 2013 im Internet Archive))
â Reinhard Wimmer, Harald Wintersberger, Günter A. Parthl: Hydromorphologische Leitbilder. FlieÃÂgewässertypisierung in ÃÂsterreich. Band 3: GroÃÂe Flüsse. Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, Wien 2012 (PDF; 2,3 MB (Memento vom 22. Dezember 2014 im Internet Archive))
â Sigmar Bortenschlager: Beiträge zur Vegetationsgeschichte Tirols I. Inneres ÃÂtztal und unteres Inntal, in: Berichte des naturwissenschaftlichmedizinischen Verein, Innsbruck 71 (1984) 19âÂÂ56 (online, PDF).
â Dirk van Husen: Zur Fazies und Stratigraphie der jungpleistozänen Ablagerungen im Trauntal, in: Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 120 (1977) 1âÂÂ130.
â a b c d e f Amt der Oö. Landesregierung, Naturschutzabteilung (Hrsg.): Natur und Landschaft â Leitbilder für Oberösterreich. Band 27: Raumeinheit Inntal. ÃÂberarb. Fassung, Linz 2007 (PDF; 6,5 MB)
â Tiroler Schutzgebiete: Mieminger – Rietzer Innauen (Memento vom 26. Oktober 2014 im Internet Archive)
â Urs Landergott: Auenentwicklung am Inn seit Inbetriebnahme der Kraftwerkstufe Pradella â Martina (1993-2010). Bericht im Auftrag der Engadiner Kraftwerke AG. Zürich 2011 (online)
â BMLFUW: Stauseen am Unteren Inn
â Allgemeines zu den Fischen im Inn, uner-inn.at (PDF; 426 kB)
â Der Europäische Biber (Castor fiber), unser-inn.at (PDF; 36 kB)
â Walter Sage: Der Fischotter Lutra lutra am âÂÂUnteren InnâÂÂ. Situation und Ausblick. In: Mitteilungen der Zoologischen Gesellschaft Braunau, Band 10, Nr. 3 (2012), S. 271âÂÂ279 (PDF; 344 kB)
â Tiroler Schutzgebiete: Silzer Innau
â Flussregenpfeifer, unser-inn.at (PDF; 90 kB)
â Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft (Hrsg.): Saprobiologische Gewässergüte der FlieÃÂgewässer ÃÂsterreichs. Stand 2005, S. 3 (PDF; 1 MB (Memento vom 22. Dezember 2015 im Internet Archive))
â Bayerisches Staatsministerium für Umwelt, Gesundheit und Verbraucherschutz und Ministerium für Umwelt und Verkehr Baden-Württemberg (Hrsg.): Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie 2000/60/EG (WRRL) Bericht zur Bestandsaufnahme für das Deutsche Donaugebiet. München 2005, S. 58 (PDF; 2,1 MB)
â a b Land Tirol/Lebensministerium ÃÂsterreich: WasserstraÃÂe Inn (PDF; 3,7 MB)
â a b Paul Eugen Grimm: Inn. In: Historisches Lexikon der Schweiz.
â Innschifffahrt auf Tirol Multimedial
â Die letzte Fahrt der St. Nikolaus auf dem Inn 2011 (Memento vom 16. Februar 2012 im Internet Archive), tirol-schiffahrt.at
â Schiff St. Nikolaus trat Reise nach Hamburg an meinbezirk.at, 30. April 2013, abgerufen 3. Februar 2018 â Bildbericht vom Ausheben am ober Kufstein gelegenen Innkraftwerk Langkampfen und StraÃÂentransport.
â Innschifffahrt endgültig eingestellt orf.at, 9. November 2011, abgerufen 3. Februar 2018.
â Umweltbundesamt (Hrsg.): Programm nach ç 9A IG-L für das Bundesland Tirol. Report REP-0119, Wien 2010 (PDF; 5,9 MB)
â Diese Vischordnung, wie die auf der Thunaw und sonst allenthalb in vnserm Fürstenthumb gehalten werden soll gilt als erster deutscher Druck, der eine naturgetreue Darstellung von Fischen enthält. Siehe Heinrich Grimm: Neue Beiträge zur âÂÂFisch-Literaturâ des XV. bis XVII. Jahrhunderts und über deren Drucker und Buchführer. In: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel â Frankfurter Ausgabe. Nr. 89, 5. November 1968 (= Archiv für Geschichte des Buchwesens. Band 62), S. 2871âÂÂ2887, hier: S. 2876âÂÂ2878 und 2882.
â Archen: âÂÂVerpfählungen von etwa 250âÂÂ300 QuartfuàgroÃÂ, die von den Ufern in Strom und Seen zum Fischfang hinausgebaut warenâÂÂ. Heinrich Grimm: Neue Beiträge zur âÂÂFisch-Literaturâ des XV. bis XVII. Jahrhunderts und über deren Drucker und Buchführer. 1968, S. 2878, 2880 und 2882.
â TIWAG plant Erweiterung des Kraftwerks Kirchbichl (Memento vom 28. März 2014 im Internet Archive)
â a b TIWAG: Kraftwerk Imst
â Innsbruck und das Hochwasser. (PDF) Abgerufen am 13. Januar 2017.
â a b Innsbruck und das Hochwasser. (PDF) Abgerufen am 13. Januar 2017.
â TIWAG: Kraftwerk Langkampfen (Memento vom 8. August 2013 im Internet Archive)
â TIWAG: Kraftwerk Kirchbichl (Memento vom 8. August 2013 im Internet Archive)
â Innsbruck und das Hochwasser. (PDF) Abgerufen am 13. Januar 2017.
â Imster Schlucht auf kajaktour.de
â Paul Arnold, Harald Küthmann, Dirk Steinhilber: GroÃÂer Deutscher Münzkatalog von 1800 bis heute, Augsburg 1997: S. 54, Bayern, Nr. 68, Inngolddukaten von 1830
.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen{border:1px solid #AAAAAA;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;padding-top:2px}.mw-parser-output div.BoxenVerschmelzen div.NavFrame{border:none;font-size:100%;margin:0;padding-top:0}
.mw-parser-output div.NavFrame{border:1px solid #A2A9B1;clear:both;font-size:95%;margin-top:1.5em;min-height:0;padding:2px;text-align:center}.mw-parser-output div.NavPic{float:left;padding:2px}.mw-parser-output div.NavHead{background-color:#EAECF0;font-weight:bold}.mw-parser-output div.NavFrame:after{clear:both;content:““;display:block}.mw-parser-output div.NavFrame+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+link+div.NavFrame,.mw-parser-output div.NavFrame+style+div.NavFrame{margin-top:-1px}.mw-parser-output .NavToggle{float:right;font-size:x-small}
Flüsse der Schweiz
Flüsse mit einer Gesamtlänge über 30 km:
Aare |
Albula |
Allaine |
Alter Rhein |
Arbogne |
Areuse |
Arve |
Birs |
Brenno |
Broye |
Calancasca |
Doubs |
Drance de Bagnes |
Dünnern |
Emme |
Engelberger Aa |
Ergolz |
Glâne |
Glatt |
Glenner (Glogn) |
Hinterrhein |
Inn (En) |
Julia (Gelgia) |
Kander |
Kleine Emme |
Landquart |
Landwasser |
Langete |
Limmat |
Linth |
Lorze |
Maggia |
Mentue |
Moësa |
Muota |
Murg |
Necker |
Orbe |
Petite Glâne |
Plessur |
Rabiusa |
Reuss |
Rhein |
Rhone |
Saane |
Schüss (Suze) |
Seez |
Sense |
Sihl |
Simme |
Sitter |
Sorne |
Suhre |
Talent |
Tamina |
Tessin (Ticino) |
Thur |
Töss |
Venoge |
Verzasca |
Vispa |
Vorderrhein |
Wigger |
Wyna
Wasserkraftwerke am Inn
Islas |
S-chanf-Pradella |
Pradella-Matina |
Gemeinschaftskraftwerk Inn |
Imst |
Kirchbichl |
Langkampfen |
Oberaudorf-Ebbs |
NuÃÂdorf |
Rosenheim |
Feldkirchen |
Wasserburg |
Teufelsbruck |
Gars |
Jettenbach |
Töging |
Neuötting |
Perach |
Stammham |
Braunau-Simbach |
Ering-Frauenstein |
Egglfing-Obernberg |
Schärding-Neuhaus |
Passau-Ingling
In Planung: Imst-Haiming (2025)
Normdaten (Geografikum): GND: 4027046-4 (OGND, AKS) | VIAF: 235899524
Abgerufen von âÂÂhttps://de..org/w/index.php?title=Inn&oldid=209172929âÂÂ
Kategorien: Flusssystem InnFluss in EuropaFluss im Kanton GraubündenFluss in BayernFluss in TirolFluss in OberösterreichGeographie (Innsbruck)Grenze zwischen Deutschland und ÃÂsterreichGewässer im Landkreis PassauGewässer im Landkreis AltöttingGewässer im Landkreis Mühldorf am InnGewässer im Landkreis RosenheimGewässer im Landkreis Rottal-InnGrenzflussGewässername keltischer HerkunftVersteckte Kategorie: Wikipedia:Weblink offline
Navigationsmenü